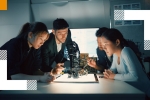Interview: „Mindest-Fallzahlen zeigen nicht gewünschte Wirkung“
28 April, 2020
Der Gesundheitsclub Rhein-Main beschäftigte sich bei seinem Treffen am 26. Februar 2020 mit dem Thema „Mythos oder Wahrheit – hängt die Qualität in der Medizin von den Fallzahlen ab?“. Prof. Dr. Thomas W. Kraus vom Frankfurter Krankenhaus Nordwest und Dr. Christian Rotering von der Park-Klinik Manhagen legten dar, inwiefern Mindest-Fallzahlen Sinn machen und warum sie trotzdem bisher nicht die gewünschte Wirkung zeigen.

Herr Burkhart, dass es für Patienten von Vorteil ist, wenn ein Krankenhaus viel Erfahrung mit bestimmten Operationen hat, leuchtet auf Anhieb ein. Gibt es beim Thema Fallzahlen denn viel zu diskutieren?
Michael Burkhart: Tatsächlich gilt: Die Qualität steigt, je öfter eine Klinik eine bestimmte Operation durchführt. Das zeigen Studien immer wieder. Trotzdem ist es politisch nicht damit getan, einfach eine bestimmte Fallzahl festzusetzen. Das beweist das Beispiel der Hüft- und Knieprothesen. Obwohl es eine gesetzliche Mindestmengen-Regelung gibt, nimmt die Zahl der Krankenhäuser, die diese Operationen anbieten, sogar deutlich zu. Waren es vor zehn Jahren rund 880, sind es aktuell 1319 Kliniken. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es zu diesen Fehlanreizen kommt und welche Alternativen es gäbe, um die Qualität in der Medizin zu sichern. Ein sehr ergiebiges Thema – vor allem wenn Experten und Entscheider aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft miteinander diskutieren, wie das im Gesundheitsclub der Fall ist.
Wie sind Fallzahlen aus medizinischer Sicht zu beurteilen?
Thomas W. Kraus: Natürlich hat es Vorteile, wenn eine Klinik bestimmte Operationen häufig durchführt oder sogar darauf spezialisiert ist. Das gilt nicht nur für den Eingriff selbst, sondern auch für die gesamte postoperative Nachbehandlung und Komplikationsbeherrschung.
Die beste Behandlung ergibt sich regelhaft, wenn ärztliche Experten die Behandlung in spezialisierten Zentren mit interdisziplinärer Kompetenz und der nötigen technischen Ausstattung erbringen.
Auf Fallzahlen basierende Analysen sind vor allem bei klar definierten Prozeduren möglich. In der klinischen Praxis haben wir es aber meist mit Patienten zu tun, die an mehreren Erkrankungen leiden. Das macht komplexe individuelle Behandlungen erforderlich, die sich nicht so leicht einem Fall zuordnen lassen.
Wie kommt es, dass trotz Mindestmengen-Regelung heute mehr Kliniken Knieoperationen anbieten als je zuvor?
Christian Rotering: Das hat wirtschaftliche Gründe. Knieoperationen sind planbare Eingriffe, die Kliniken das geschäftliche Überleben sichern. Krankenhäuser stehen durch die Mindestmenge-Regelung deswegen eher im Wettbewerb um die Anzahl der Patienten als um die Qualität in der Behandlung. Ein klarer Fehlanreiz.
Wie könnte man gegensteuern?
Kraus: Bei wirklich komplexen Operationen, also im Bereich klar definierter Spitzenmedizin, sind Zentren mit großen Fallzahlen alternativlos. Für solche Eingriffe kann Patienten auch eine weitere Anfahrt zugemutet werden. Im Bereich der Pankreas- und Speiseröhrenchirurgie, aber auch bei der komplexen Endoprothetik wird darüber nachgedacht, die gesetzlichen Mindestmengen so weit hochzusetzen, dass kleine Krankenhäuser sie so oder so nicht erreichen können. Dies macht Fehlindikationen, um Mindestmengen zu erreichen unnötig, und definiert klare Qualitätsansprüche.
Rotering: Bei Hüft- und Knieoperationen zeichnet sich bereits heute eine weitere Möglichkeit ab, um Kliniken mit guter Qualität zu stärken. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. hat in Zusammenarbeit mit gesetzlichen Krankenkassen ein Endoprothesen-Register für Deutschland aufgebaut, das Daten aus Kliniken sammelt und auswertet (eprd.de). Es zeigt, wie lange Prothesen halten und wie oft es nach der Operation zu Komplikationen kommt.
Die Unterschiede zwischen den Krankenhäusern sind riesig. Bisher ist die Teilnahme an diesem Register freiwillig. Doch das ändert sich ab nächstem Jahr: Dann müssen laut Gesetz alle Kliniken, die solche Operationen anbieten, dem Register ihre Daten zur Verfügung stellen.
Die Auswertung wird dann zentral veröffentlicht und ist für alle einsehbar. Das schafft für Patienten die nötige Transparenz und hilft, die Marktposition qualitativ hochwertiger Einrichtungen zu stärken.
Kraus: Wenn es besser gelingen würde, die Vergütung von der Menge zu lösen, könnte sich in der Medizin vieles fundamental verändern. Es wird strategisch über regionale Versorgungsmodelle nachgedacht, bei denen die Leistungserbringer eine Pro-Kopf-Pauschale je Versichertem erhalten. Das würde auch Anreize schaffen, mehr Geld für Prävention auszugeben, um die Gesundheit der Versicherten zu fördern und so gegebenenfalls nachhaltig Profit zu erzielen. Aber ich möchte es gerne noch grundsätzlicher ausdrücken:
Wir sollten die Medizin nicht nur ökonomisch, sondern auch als eine Kulturinstitution begreifen. Eine Gesellschaft muss sich eine gute Versorgung leisten wollen – genau wie Bildung.
Contact us

Roland M. Werner
Partner, Leiter Gesundheitswirtschaft & Pharma, PwC Germany
Tel.: +49 170 7628-557