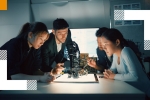Interview „Künstliche Intelligenz in der Medizin sorgt für Qualität und Wirtschaftlichkeit“
14 März, 2019
Künstliche Intelligenz (KI) wird das Gesundheitswesen revolutionieren – davon ist die Mehrheit der Entscheider in der Gesundheitswirtschaft überzeugt. Doch wenn es darum geht, KI in den medizinischen Alltag zu integrieren, reagieren viele Führungskräfte zögerlich, wie die PwC-Studie „From Virtual to Reality“ zeigt.
Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC, und Sevilay Huesman-Koecke, bis 2022 Head of Business Development Gesundheitswirtschaft, erklären im Interview, worauf es beim erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz ankommt und wo Deutschland derzeit steht.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Deutschland zu einem der führenden Standorte für Künstliche Intelligenz zu machen. Wo sehen Sie das deutsche Gesundheitssystem bei dem Thema?
Michael Burkhart: Wir stehen noch ganz am Anfang der Entwicklung. Zwar forschen schon zahlreiche Unternehmen der Gesundheitswirtschaft zur Künstlichen Intelligenz und stoßen Pilotprojekte an, doch in der Therapie von Patienten ist die Technologie noch nicht angekommen. Den Entscheidern ist aber durchaus bewusst, wie mächtig Künstliche Intelligenz ist: Wie die PwC-Studie belegt, sind 64 Prozent der Führungskräfte im deutschen Gesundheitswesen überzeugt davon, dass KI unser Gesundheitswesen in den kommenden zehn Jahren grundlegend verändern wird. Ähnlich hoch ist der Zustimmungswert nur noch im Mittleren Osten mit 63 Prozent.
Wie weit sind die Unternehmen in der konkreten Umsetzung?
Burkhart: Zwischen Überzeugung und Praxis klafft eine große Lücke – nur 30 Prozent der Entscheider in Deutschland haben erste KI-Lösungen implementiert. Im Mittleren Osten liegt dieser Wert bei lediglich zehn Prozent. Andere europäische Länder sind in ihrer Umsetzung deutlich weiter, beispielsweise Skandinavien und Belgien, bleiben aber dennoch hinter den weltweiten Spitzenreitern USA und China zurück.
Wodurch werden die Unternehmen der Gesundheitswirtschaft nach Ihrer Einschätzung ausgebremst?
Burkhart: Wie unsere Studie belegt, fühlt sich ein Viertel der befragten Unternehmer nicht ausreichend auf das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz vorbereitet – weil den Studienteilnehmern die finanziellen Mittel fehlen und weil sie glauben, dass weder die Belegschaft noch die Führungsspitze schon fit für Machine Learning sind. In Deutschland müssen auch zahlreiche Fragen zur Regulierung geklärt werden, etwa im Bereich Datenschutz. Hinzu kommt aber auch, dass wir im Gesundheitswesen den echten Mehrwert solcher Innovationen noch nicht greifbar gemacht haben. Wenn wir uns zum Beispiel Online-Banking oder den Konsumgütermarkt anschauen, stellen wir fest, dass hier der Nutzen digitaler Lösungen für den Verbraucher erlebbar gemacht wurde, auch wenn Cyber-Sicherheit und Vertrauen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Im Gesundheitswesen fehlt dieses Erlebnis bislang. Erst wenn die Anbieter es schaffen, den Patienten und Versicherten die Vorteile und den Nutzen neuer Technologien zu verdeutlichen, hat die Anwendung Künstlicher Intelligenz im deutschen Gesundheitswesen eine Chance.
Ist das Potenzial von Künstlicher Intelligenz denn so groß, dass der Mehrwert das Risiko kompensieren kann?
Sevilay Huesman-Koecke: Ja, definitiv. Artificial Intelligence löst einen Zielkonflikt, der bisher in unserem Gesundheitssystem nicht aufzulösen war – entweder gelang es uns, die medizinische Versorgung für den Patienten zu verbessern oder die Kosten in unserem teuren Gesundheitswesen zu senken. Künstliche Intelligenz macht es zum ersten Mal möglich, beide Ziele zu vereinbaren, für Qualität und Wirtschaftlichkeit zu sorgen. Wie eine PwC-Vorgänger-Studie belegt, kann KI dazu beitragen, in den kommenden zehn Jahren in Europa die Gesundheits- und Folgekosten um knapp 200 Milliarden Euro zu senken. Bei konsequenter Umsetzung können wir es also schaffen, den Anteil der Behandlungskosten von zurzeit 70 Cent auf unter 50 Cent pro Dollar, der für das Gesundheitswesen ausgegeben wird, zu reduzieren. Einen hohen Nutzen hat Künstliche Intelligenz auch bei der Früherkennung von Demenz und der Diagnose und Behandlung von Brustkrebs.
Wie bewerten Sie den klinischen Nutzen?
Huesman-Koecke: Der ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Künstliche Intelligenz unterstützt nicht nur bei der Diagnose, sondern erlaubt im Anschluss auch eine Aussage darüber, welche Therapie am besten wirken wird – so wie unsere Software PHREND (Predictive Healthcare with Real-world Evidence for Neurological Disorders), die wir gemeinsam mit dem Ärztenetzwerk NeuroTransData entwickelt haben. Sie ermöglicht Patienten mit Multipler Sklerose einen personalisierten Vergleich zwischen verschiedenen Therapieoptionen und sagt voraus, welches Medikament am besten wirkt. Hier endet das Potenzial aber nicht, im Gegenteil: In naher Zukunft ist damit zu rechnen, dass wir mit Künstlicher Intelligenz nicht nur Therapien unterstützen, sondern auch voraussagen können, wer mit wie hoher Wahrscheinlichkeit welche Krankheiten bekommt. Hier bewegen wir uns dann im Bereich der Prävention, welcher der Diagnose und der Therapie vorgeschaltet ist und daher auch das gesamte Gesundheitswesen beeinflusst.
Wie wichtig ist die Akzeptanz solcher KI-Einsatzmöglichkeiten bei Health Professionals?
Burkhart: Mitarbeiter, die täglich im medizinischen Alltag KI nutzen, müssen Vertrauen in die Technologie haben – das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Hierfür muss die Führungsebene aber auch ganz klar in ihrer Kommunikation sein und deutlich machen, dass keine Arbeitsplätze gefährdet sind, sich einzelne Jobprofile aber stark wandeln können. Daher ist es entscheidend für den erfolgreichen Einsatz von KI, dass Unternehmen nicht allein in Technologie investieren, sondern auch in die Aus- und Weiterbildung ihrer Angestellten. Die Belegschaft profitiert aber auch von KI-basierten Lösungen. Beispielsweise werden sie von Routinetätigkeiten entlastet und können die Künstliche Intelligenz auch dafür einsetzen, für komplexe Krankheitsbilder eine erste Entscheidungsgrundlage zu erhalten.
Health Professionals sind nur eine Seite der Medaille – sind Patienten schon bereit für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Robotik?
Huesman-Koecke: Eindeutig ja! In einer PwC-Umfrage mit 11.000 Teilnehmern aus zwölf Ländern haben wir diese Frage gestellt. Das Ergebnis stimmt optimistisch: Mehr als die Hälfte der Patienten weltweit kann sich vorstellen, ärztliche Aufgaben in Zukunft von Künstlicher Intelligenz und Robotik durchführen zu lassen, knapp die Hälfte würde kleinere Eingriffe von einem Roboter erledigen lassen. Die Bereitschaft hängt allerdings vom Herkunftsland ab – so ist die Akzeptanz von KI in Industriestaaten mit gut ausgebauten Gesundheitssystemen geringer als in Schwellenländern. Das Vertrauen in der Bevölkerung ist ein zentraler Faktor für die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz. Deshalb ist es so wichtig, in den Dialog mit der Öffentlichkeit zu gehen.
Hinweis: Die Ergebnisse zum Mittleren Osten beziehen sich auf die PwC-Studie „From Virtual to Reality“.
Die PwC-Experten zum Thema

Michael Burkhart
Michael Burkhart ist Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC Deutschland sowie Standortleiter Frankfurt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei PwC. Seine Branchenexpertise umfasst das gesamte Gesundheitswesen – von Krankenhäusern über gesetzliche Krankenkassen, Pflegeheime, Diagnostikunternehmen, Medizinprodukte und Organisationen des öffentlichen Sektors.

Sevilay Huesman-Koecke
Sevilay Huesman-Koecke war bis 2022 Senior Managerin und Head of Business Development im Bereich Gesundheitswirtschaft bei PwC. Außerdem ist die Expertin Initiatorin des externen PwC-Frauennetzwerkes women&healthcare.
Contact us

Roland M. Werner
Partner, Leiter Gesundheitswirtschaft & Pharma, PwC Germany
Tel.: +49 170 7628-557