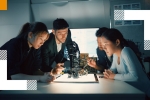Wirtschaftlich an der Spitze sind weiterhin die Kliniken in privater Trägerschaft
Ein Interview mit Michael Burkhart und Corinna Friedl. Wie gehen deutsche Krankenhäuser mit steigendem Kostendruck um? Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Gibt es Reformbedarf im Krankenhausmanagement? Fragen wie diese
hat PwC in einer Benchmark-Analyse beantwortet. Dabei betrachtet PwC die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen – eine Aussage über die Qualität medizinischer und pflegerischer Leistungen lässt sich daraus nicht ableiten.

Herr Burkhart, Kliniken agieren unter hohem Kostendruck. Sie sollen effizient wirtschaften und zugleich Patienten bestmöglich versorgen. Welchen Krankenhausträgern gelingt dieser Spagat Ihrer Analyse zufolge am besten?
Michael Burkhart: Wirtschaftlich an der Spitze befinden sich weiterhin die Kliniken in privater Trägerschaft. Sie wirtschaften im Schnitt deutlich rentabler als die Kliniken in anderer Trägerschaft. Damit bestätigt unsere aktuelle Benchmark-Analyse auch unsere Untersuchungen vergangener Jahre. Insbesondere der Vorsprung zu den öffentlichen Krankenhäusern wird immer größer.
Woran liegt das?
Burkhart: Fördermittel zu beantragen, ist sehr aufwändig und langwierig. Die Kliniken in privater Trägerschaft beenden Investitionsvorhaben häufig schneller und effizienter, wenn sie sich diesen Aufwand und die Wartezeiten sparen.
Welche Faktoren sind für die bessere wirtschaftliche Situation der Kliniken in privater Trägerschaft ausschlaggebend?
Corinna Friedl: Sie verfügen oft über effizientere Strukturen als freigemeinnützige und öffentliche Häuser. Zum Beispiel bei der digitalen Infrastruktur: Weil die Kliniken in privater Trägerschaft meist in Ketten organisiert sind, können sie aufgrund der stärkeren Zentralisierung Synergieeffekte nutzen – unter anderem deshalb wird ja häufig gefordert, dass sich auch die Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft stärker zu Verbünden zusammenschließen. Denn klar ist: Besonders bei der Digitalisierung wird die Schere zwischen den Trägerarten immer größer.
Können Sie ein weiteres Beispiel für effizientere Strukturen geben?
Friedl: Das fängt häufig schon bei den Gebäuden an. Moderne Gebäude bieten kürzere Wege für das Pflegepersonal, weshalb ihnen unterm Strich mehr Zeit am Patienten bleibt. Betriebswirtschaftlich ausgedrückt: mehr Zeit für abrechenbare Leistungen.
Bleiben wir beim Thema Personal. Sie haben in Ihrer Untersuchung auch die Material- und Personalaufwandsquoten ermittelt. Mit welchem Ergebnis?
Friedl: Kliniken in privater Trägerschaft geben 84 Prozent ihres Umsatzes für Belegschaft und Material aus. Bei öffentlichen Krankenhäusern sind es 92 Prozent. Das heißt: Von 100 Euro an Einnahmen bleiben den öffentlichen Kliniken gerade einmal 8 Euro für Instandsetzung, Investitionen in Digitalisierung oder Finanzierung übrig. Aber auch die freigemeinnützigen Krankenhäuser haushalten besser als ihre öffentlichen Mitbewerber. Sie haben derzeit eine Personalaufwand- und Materialkostenquote von 88 Prozent.
Ist dieser geringere Anteil ein Zeichen, dass private Träger am Personal sparen?
Burkhart: Häufig ist unbekannt, dass die Berufe am Patienten nach einem Wechsel zu einem privaten Träger einen Zuwachs erfahren. Ärzte und Pflegekräfte werden neu eingestellt. Allerdings werden patientenferne Berufe, z.B. Reinigungs- und Servicekräfte, häufig outgesourct.
Im Jahr 2019 erhöhte sich diese Quote aber für alle Träger. Warum?
Burkhart: Das ist richtig. Der leichte Anstieg ist vor allem auf den Pflegekräftemangel zurückzuführen. Die Kliniken brauchen deswegen mehr Personal und zusätzliches Leihpersonal – das bedeutet hohe Kosten, die nicht vollständig refinanziert werden. Damit stehen die einzelnen Träger vor massiven finanziellen Herausforderungen.
„Eine konsequente Digitalisierung hilft Krankenhäusern, ihre immensen Herausforderungen zu meistern.“
Welche Rolle spielt moderne Technik zum Beispiel für administrative Tätigkeiten?
Burkhart: In der Praxis kann eine moderne Bau- und Dateninfrastruktur den menschlichen Arbeitsaufwand reduzieren. Dadurch wird der Fachkräftemangel etwas abgemildert und die Effizienz erhöht. Eine konsequente Digitalisierung hilft Krankenhäusern, ihre immensen Herausforderungen zu meistern. Zurzeit gilt dies vor allem für Verwaltungs- und ähnliche unterstützende Kräfte. Die große Revolution im Gesundheitswesen steht allerdings noch aus.
In welchem Maß sind Kliniken auf externe Geldgeber angewiesen?
Burkhart: Krankenhäuser aller Trägerschaften sind auf externe Geldgeber angewiesen – mit entsprechend hohen Kapitalkosten. Das ist ein systemisches Problem und liegt daran, dass die öffentliche Hand ihrer Aufgabe als Geldgeber nicht in ausreichender Weise nachkommt – Stichwort Investitionsstau. Der Unterschied ist, dass Kliniken in privater Trägerschaft mehr Geldquellen zur Verfügung stehen, um dieses Versäumnis etwas auszugleichen.
Wie drückt sich das mit Blick aufs Eigenkapital in Zahlen aus?
Friedl: Die durchschnittliche Eigenkapitalquote bei öffentlichen Krankenhäusern nur 10,2 Prozent. Auch bei dieser Kennzahl schneiden private Kliniken mit 29,4 Prozent wesentlich besser ab. Nur knapp darunter liegen die freigemeinnützigen Krankenhäuser – mit durchschnittlich 28,3 Prozent Eigenkapitalquote.
Wie können sich öffentliche Kliniken weniger abhängig von Fremdkapital machen?
Friedl: Beispielsweise indem sie ihr Cash-Management verbessern. Da sehe ich großes Potenzial. Denn die Häuser in öffentlicher Trägerschaft verzichten auf viel Geld, weil sie ihre Forderungen gegenüber den Krankenkassen viel zu spät geltend machen. Bei ihnen liegt die sogenannte Forderungsreichweite in Tagen bei 59; bei den privaten Krankenhäusern sind es nur 46.
Weiteren Kostendruck verursachen nachträgliche Rechnungskorrekturen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, die sogenannte MDK-Umsatzquote. Was bedeutet das für die Kliniken?
Friedl: Diese Quote beeinflusst das Jahresergebnis direkt. Hatten die Kliniken im Jahr 2017 nachträglich noch Erlöskürzungen von 2,1 Prozent erwartet, stieg die Quote bis Ende 2019 auf 2,4 Prozent.
Unter dem Strich stehen die deutschen Kliniken vor immensen Herausforderungen. Wie könnte man die Krankenhausfinanzierung verbessern?
Burkhart: Ich schlage eine Pro-Einwohner-Finanzierung vor. Diese würde ganz andere Anreize setzen. Ein Krankenhaus wäre zuständig für eine bestimmte Region, sagen wir für 20.000 Bürger in einem Umkreis von 30 Kilometern. Für die Behandlung erhielte die Klinik einen festgelegten Betrag pro Einwohner, im Fachjargon „per capita“ genannt. Das Krankenhaus wäre dann nicht mehr – wie aktuell – abhängig davon, wie viele Menschen tatsächlich seine Leistungen in Anspruch nehmen.
„Bei der Pro-Einwohner-Finanzierung wären Kliniken profitabler, wenn sie weniger Menschen behandeln würden. Prävention und Behandlungsqualität würden dann wichtiger werden.“
Können Sie den Vorteil noch etwas genauer erläutern?
Burkhart: Je weniger Menschen eine Klinik behandeln würde, desto profitabler wäre sie. Der wesentliche Vorteil dieser Finanzierungsvariante wäre, dass die Krankenhäuser zu mehr Prävention und zu einer höheren Behandlungsqualität motiviert würden. Denn je besser ein Krankenhaus seine Patienten bei der Gesundheitsvorsorge unterstützt und je besser es sie versorgt, desto weniger müssten diese Menschen dann behandelt werden.
Hätte dieses Modell auch Nachteile?
Burkhart: Klinikmitarbeiter könnten auf den Gedanken kommen, Patienten abzulehnen, um die Profitabilität zu steigern. Diese Patienten müssten dann auf ein weiter entferntes Krankenhaus ausweichen.
Oder Patienten wollen lieber in eine andere Klinik, weil sie mit der Qualität ihres „Heimat-Krankenhauses“ unzufrieden sind oder lieber in eine Fachklinik möchten.
Burkhart: Ja. Beides ließe sich durch eine Art „Strafgebühr“ bei wechselwilligen Patienten abfedern. Das heißt, die eigentlich zuständige Klinik müsste dem behandelnden Krankenhaus einen bestimmten Betrag für seinen Mehraufwand bezahlen. Es gibt aber einen weiteren Nachteil an einer solchen Pro-Einwohner-Finanzierung.
Nämlich welchen?
Burkhart: Modellversuche zu dieser Art der Finanzierung haben gezeigt, dass die Krankenhäuser ihre Ausgaben für Forschung und Lehre drastisch reduzieren. Denn sie können ihr Budget dann fast ausschließlich für die medizinische Versorgung einsetzen. Deshalb möchte ich betonen, dass die Per-Capita-Finanzierung nur im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen voll wirkt – zum Beispiel der monistische Klinikfinanzierung durch die Krankenkassen. Die Universitätskliniken und akademischen Lehrkrankenhäuser, an denen Forschung und Lehre ja hauptsächlich stattfindet, sollten weiter von Bund und Ländern finanziert werden. Die Pro-Einwohner-Finanzierung wäre daher aus meiner Sicht ein zentraler Baustein in einer Gesamtstrategie, die den schleichenden Qualitätsverlust im deutschen Gesundheitssystem abzumildern helfen kann.