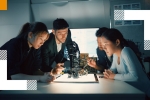Bilanzierung von Software
29 April, 2021
Ein Interview mit WP StB Prof. Dr. Rüdiger Loitz und Martin Weckenmann. Unternehmen nutzen im Zuge ihrer digitalen Transformation immer häufiger Cloud-Lösungen. Das wirft neue Fragen bei der Bilanzierung auf.
Die größten Herausforderungen erläutern Prof. Dr. Rüdiger Loitz, Leiter des Bereichs Capital Markets & Accounting Advisory Services, und Martin Weckenmann, Senior Manager im Bereich Capital Markets and Accounting Advisory Services, von PwC Deutschland.

Warum entwickelt sich aus Ihrer Sicht die Bilanzierung von Software aktuell zu einem „Hot Topic“?
Rüdiger Loitz: Software ist eine wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Ressource der digitalen Transformation. Von der softwareintensiven Künstlichen Intelligenz und Blockchain bis hin zur Kapazitäten schaffenden Cloud-Technologie und dem Quanten-Computing – all diese neuen Technologien basieren im Wesentlichen auf immateriellen Werten. Dies führt zwangsläufig dazu, dass die Investitionen in Software, aber auch der Absatz von Software zu wesentlichen Cash In- und Outflows führen.
Martin Weckenmann: Hinzu kommt, dass internationale Rechnungslegungsstandards bislang nicht adäquat weiterentwickelt worden sind. Deshalb sind zentrale Fragen zur Bilanzierung von Software unbeantwortet.
Unternehmen entwickeln folglich eigene Lösungen – und die haben zum Teil erhebliche Ermessenspielräume.
Welche Probleme ergeben sich daraus für Unternehmen in der Praxis?
Loitz: Die Herausforderungen werden, genau wie die Software selbst, vielfältiger und betreffen sowohl die Beschaffungs- als auch die Absatzseite. Bei der Beschaffung ist die sachgerechte Zuordnung der Kosten in aktivierungsfähige und nichtaktivierungsfähige Kosten eine große Herausforderung. Dies wird dadurch verschärft, dass bei der Software-Entwicklung statt auf die klassischen Wasserfallansätze vermehrt auf agile Methoden zurückgegriffen wird. Letztgenannte befreien Unternehmen jedoch nicht davon, nach Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten zu unterscheiden, erschweren die Zuordnung aber deutlich.
Weckenmann: Darüber hinaus werden die Dokumentationsanforderungen bei der Jahresabschlusserstellung immer höher. Wesentliche Investitionen in Software führen dazu, dass unsere Mandanten zum Beispiel die Berechnung der durchschnittlichen Kostensätze, die Zuordnung externer Beraterkosten oder das Erreichen von Projektmeilensteinen genau nachweisen müssen.
Und welche zentralen Herausforderungen sehen Sie auf der Absatzseite?
Loitz: Ein sehr häufiges Problem resultiert aus der Ermittlung von Stand-alone Selling Prices (SSP) bei der Umsatzrealisierung. Software wird fast immer mit sogenanntem Post Contract Customer Support (PCS) verkauft. Mit dieser Supportzusage erhalten Kunden diverse Leistungen, etwa Updates, Upgrades und Hotline-Support. Die zugrundeliegende Software wäre aber grundsätzlich auch ohne diese Wartungsleistungen funktionsfähig.
Deshalb werden Software und Wartung regelmäßig als unterschiedliche Leistungsverpflichtungen eingestuft. In der Praxis werden diese Wartungsleistungen jedoch nicht getrennt von der Software verkauft, weswegen es keine beobachtbaren Marktpreise gibt.
Wie lässt sich das lösen?
Loitz: Manche nennen den sogenannten Cost Plus a Margin Approach bei Software-Produkten als Alternative. Das ist in der Regel aber nicht so, weil sich Kosten auf Produktebene nicht verlässlich ermitteln lassen. Deshalb greifen viele Unternehmen auf Näherungslösungen zurück – und die sind, wie gesagt, zum Teil mit erheblichem Ermessen behaftet.
Weckenmann: Immer mehr Mandanten befinden sich zudem inmitten einer Cloud-Transformation und bieten statt klassischer On-Premise-Lizenzen zunehmend Software-as-a-Service-Lösungen an. Die Transformation findet dabei oftmals über sogenannte Hybrid-Cloud-Lösungen statt. Dabei wird im ersten Schritt nur ein Teil der On-Premise-Funktionalitäten in die Cloud verlagert, während sensible Daten lokal verbleiben. Die Richtlinien für die Umsatzrealisierung sind recht klar: Bei On-Prem-Lizenzen wird der Umsatz in der Regel mit der Auslieferung realisiert, bei SaaS-Lösungen erfolgt dies meist ratierlich.
Und wie sieht es bei den Regelungen für Hybrid-Cloud-Lösungen aus?
Weckenmann: Sie sind nicht eindeutig, das ist ein Problem. Viele unserer Mandanten fragen sich deshalb: Wann sind ausreichend Funktionalitäten in der Cloud vorhanden, um bilanziell von einem Cloud-Modell mit ratierlicher Umsatzrealisierung auszugehen?
Wie unterstützen Sie Ihre Mandanten konkret?
Loitz: Wir bieten, passend zur jeweiligen Situation, sehr unterschiedliche Lösungsansätze an, weil unser Team eine sehr hohe Branchenexpertise hat. Häufig geht es darum, die erwähnten Ermessensspielräume transparent zu machen und getroffene Entscheidungen prüfungssicher zu dokumentieren.
Bei großen IT-Implementierungsprojekten unterstützen wir Mandanten beispielsweise dabei, Accounting-Richtlinien zu erstellen, anfallende Kosten zu kategorisieren und durchschnittliche Stundensätze herzuleiten.
Was sind häufige Fragstellungen bei der Umsatzrealisierung?
Loitz: Dabei beschäftigen wir uns regelmäßig mit Methoden, um SSPs zu ermitteln, aber auch mit der Analyse der erwähnten Hybrid-Cloud-Modelle. Regelmäßig werden wir auch bei Due-Diligence-Projekten hinzugezogen und analysieren beispielsweise, ob hinter den Cloud Revenues auch tatsächlich Umsätze aus Cloud-Produkten stehen.
Weckenmann: Wir unterstützen unsere Mandanten darüber hinaus mit toolgestützten Lösungen. Wir haben zum Beispiel ein Tool entwickelt, mit dem Anwender Entwicklungsaufwand erfassen, kategorisieren und analysieren können. Neben der Zuordnung in aktivierungs- und nichtaktivierungsfähige Kosten ermöglicht das Tool beispielsweise, Budgetabweichungen oder die Auslastung der Software-Entwickler zu analysieren.
Gibt es auch Tools für Fragen zur Umsatzrealisierung?
Weckenmann: Ja, dafür nutzen wir komplexe sogenannte Deferred-Revenue-Roll-off-Modelle. Damit können unsere Mandanten ihre zukünftigen Umsatzerlöse simulieren.
Wir berücksichtigen dabei stets das Geschäftsmodell, zum Beispiel den jeweiligen Anteil von On-Premise- und SaaS-Lösungen, sowie die erwarteten Wachstumsraten und Churn Rates.

WP StB Prof. Dr. Rüdiger Loitz
Professor Dr. Rüdiger Loitz ist seit 1997 als Accounting Berater in dem Bereich CMAAS (Capital Markets & Accounting Advisory) tätig und arbeitet insbesondere an der Schnittstelle zwischen internationaler/nationaler Rechnungslegung/Steuern und prozessorientierten Themenstellungen. Seit 2015 leitet er CMAAS mit deutschlandweit etwa 250 Mitarbeitern. Er ist Mitglied im Assurance Leadership Team und dort neben CMAAS verantwortlich für die Digitale Roadmap von Assurance. Rüdiger Loitz ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Deutschland sowie zugelassener CPA in Boston, USA. Er hat seit 2009 einen Lehrauftrag für Internationale Rechnungslegung und Tax Accounting an der Universität zu Köln und veröffentlicht regelmäßig aktuelle Themen der internationalen Rechnungslegung und Digitalisierung.

Martin Weckenmann
Martin Weckenmann hat mehrere Jahre in unserer Silicon Valley Niederlassung gearbeitet und dort vor allem internationale Großkunden und Startups in der Software Branche beraten. Seit seiner Rückkehr aus Kalifornien unterstützt er unsere Mandanten mit seiner Expertise zu den vielfältigen Themen der Software-Bilanzierung, wie z.B. Umsatzrealisierung bei der Veräußerung von Software, Aktivierung von selbstentwickelter Software als auch Business Combinations, Purchase Price Accounting und Due Diligences im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Unternehmens.
Contact us

WP StB CPA Prof. Dr. Rüdiger Loitz
Partner, COO Assurance und Leiter Kapitalmarkt- und Rechnungslegungsberatung, PwC Germany