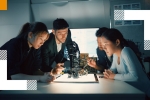China ist von so großer Bedeutung, dass sich das oberste Management darum kümmern muss. Das sehen die meisten Unternehmen so. Eines aber ist kaum einer Unternehmensleitung bewusst: Die aktuelle Situation ist eine Bewährungsprobe für ihr Risikomanagement. Eine Geschäftsstrategie in China erfolgreich umzusetzen war schon immer eine Herausforderung.
2023 ist die Risikolage jedoch erheblich komplexer geworden. Was verursacht diese Vielschichtigkeit? Was können Unternehmen in dieser Situation unternehmen? Wie können die Risiken objektiv analysiert, gewichtet und reduziert werden? Dieser Beitrag zeigt auf, welche Bereiche Risiken bergen, und skizziert einen Lösungsansatz.
Regulatorischer Marktzugang
Der Marktzugang ist nicht nur in China stark reguliert. Seit Kurzem gibt es Bestrebungen, den europäischen Markt von Produkten „Made in China“ abzuschotten. Der Zugang zum europäischen Markt wird durch eine Reihe von Maßnahmen neu geordnet, unter anderem durch Gesetzgebung (der geplante European Supply Chain Act), die sich unmittelbar auf die Lieferketten, aber auch die Produkte für Endkonsumenten auswirkt.
Europa soll von chinesischen Produkten abgeschottet werden
Wie wird sich das auf europäische Unternehmen auswirken, die an ihren chinesischen Standorten produzieren und nach Europa exportieren? Was bedeutet das für die globalen Lieferketten, aber auch für Unternehmen in der globalen Wertschöpfungskette eines Endprodukts, das von diesen Regularien betroffen ist?
Lieferketten und Transportwege
Die Lieferketten stehen seit Ausbruch der Pandemie im Brennpunkt und werden zunehmend nicht nur „de-risked“, sondern auch politisiert. Rohstoffe wie kritische Mineralien oder chemische Grundstoffe (Basischemie) werden nach Ursprungsregion gewichtet. Kriterien für eine solche Einordnung sind das politische System des Ursprungsstaats, welche Systeme er unterstützt und welchem geopolitischen Block er demnach zuzuordnen ist. Ein gutes Beispiel dafür, welche Komplikationen sich daraus ergeben können, ist Kobalt. Der geplante Abbau des Metalls in Indonesien wurde umgehend dahin analysiert, aus welchen Ländern die Unternehmen stammen, die sich die Schürfrechte gesichert haben, das Rohmaterial abbauen und es raffinieren. Dass es sich dabei um chinesische Unternehmen, Unternehmen mit chinesischen Beteiligungen oder Abkommen mit chinesischen Unternehmen handelt, bewerteten Analysten als kritisch für europäische Interessen. Das Dilemma: Der größte Teil des Kobalts wird auf dem afrikanischen Kontinent abgebaut, mehrheitlich von chinesischen Unternehmen.
Waren über die Türkei umzuleiten verändert die Machtverhältnisse
Transportwege werden aufgrund von Spannungen blockiert oder verlegt, teilweise mit dramatisch höheren Kosten. Die viel gefeierte Eisenbahnlinie von China nach Europa kann auf der Linienführung durch Russland und die Ukraine seit Februar 2022 nicht mehr genutzt werden. Die Umleitung führt durch die Türkei, was wiederum die Machtverhältnisse bei Verhandlungen verändert, die im Grunde nichts mit dem Transport von China nach Europa zu tun haben, bedingt ferner neue Verträge oder hat zumindest Folgen für die bestehenden Vertragssituationen. Das Recht, Russland zu überfliegen, wurde für viele Nationen aufgehoben, allerdings nicht für chinesische Fluggesellschaften. Nun verlangen nicht chinesische Airlines eine Beschränkung dieser Flüge.
Was bedeutet das für die Kosten, die Termine und die in den Lieferverträgen eingegangenen Modalitäten? Können die erhöhten Kosten an Kunden und Endabnehmer weitergeleitet werden?
Geopolitische Spannungen und Sanktionen
Die Medien dokumentieren und kommentieren die geopolitischen Spannungen beinahe täglich. Zu konstatieren sind die größten in den vergangenen 80 Jahren zu beobachtenden Veränderungen. Den Sanktionen der USA und Europa gegenüber Russland haben sich viele Länder im globalen Süden nicht angeschlossen. China und Indien beharren auf ihrer Neutralität. Diese Position ist für „den Westen“ nicht nachvollziehbar, was zusätzliche Spannungen aufbaut.
Die Sanktionen der USA gegenüber China werden ausgeweitet und umfassen mittlerweile ganze Industrie- und Technologiebereiche. Die europäischen Unternehmen müssen mit großem Aufwand dokumentieren und sicherstellen, dass die Produkte für den jeweils zu beliefernden Markt keine verbotenen Technologien, Prozesse, Patente oder Materialien enthalten.
Die Europäische Union beabsichtigt ebenfalls Sanktionen gegenüber Unternehmen in Drittstaaten, die die Sanktionen gegen Russland unterlaufen oder umgehen. Wie wird China darauf reagieren? Wird es, wie angedroht, die von Huawei entwickelten Patente für die 5-G-Technologie für europäische Firmen sperren? Welche Konsequenzen hat das für ein europäisches Unternehmen, das für die globale digitale Wartung und Überwachung seiner Produkte und Dienstleitungen (Internet of Things, IoT) auf diese Technologie setzt?
Digitalisierung, Datenschutz und grenzüberschreitender Datenaustausch
Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet voran, unter anderem infolge des IoT. Dabei werden Daten generiert, die für die industrielle Wertschöpfung essenziell sind. Entsprechend sind diese Daten der „Rohstoff“ für neue Geschäftsmodelle und daher ebenso wertvoll wie schützenswert. Das haben die Behörden erkannt und entsprechende Regularien in Kraft gesetzt. Diese führen aber zu einer Komplexität, die es für viele Unternehmen zunehmend schwierig macht, in allen relevanten Märkten regelkonform zu sein.
Daten zu schützen erhöht die Komplexität
Was vielen Unternehmen nicht bewusst ist: Ein Begriff kann von Regulator zu Regulator unterschiedlich interpretiert werden und erlaubt damit der jeweiligen Obrigkeit eine andere Auslegung der Gesetze. Europäische Medien haben die Durchsuchung von Büroräumlichkeiten von Bain & Company, Mintz und anderen Unternehmen in China kommentiert. Was den meisten Beobachtern allerdings nicht klar zu sein scheint: Das Vorgehen liegt in einer langjährigen Tradition der chinesischen Behörden begründet. Sie verschaffen der Durchsetzung von Gesetzen Geltung, indem sie ausländische Unternehmen öffentlichkeitswirksam kontrollieren. Chinesische Behörden und Medien bezeichnen die entsprechende neue Gesetzgebung deshalb auch „Anti-Spionage-Gesetz“.
Datenvorschriften werden aggressiv durchgesetzt
Zusammen mit Gesetzen, die den grenzüberschreitenden Austausch von Daten bewilligungspflichtig machen oder unter Strafandrohung verbieten, macht das die Situation für viele Unternehmer noch komplexer und unübersichtlicher. China ist bei der Durchsetzung seiner Datenvorschriften sehr aggressiv vorgegangen. So wurde beispielsweise das Dienstleistungsunternehmen Didi, das Fahrdienstleistungen anbietet, im Sommer 2022 mit einer Strafe von 1,2 Milliarden US-Dollar belegt. Hinzu kommt: In China droht persönliche Haftung. Verantwortliche Personen können mit Geldstrafen belegt und für eine gewisse Zeit von der Ausübung wichtiger Positionen ausgeschlossen werden. Die chinesischen Strafverfolgungsbehörden berichteten, dass sie allein im Jahr 2021 17.000 Personen wegen Datenverstößen verhaftet haben. Unternehmen, die in China tätig sind, müssen daher umgehend Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Viele internationale Unternehmen haben in den letzten Jahren die Einhaltung der Datenschutzgesetze in den USA und Europa sichergestellt. In vielerlei Hinsicht wurden die neuen chinesischen Anforderungen an die globalen Rechtsvorschriften wie die Allgemeine Datenschutzverordnung der Europäischen Union (GDPR) angeglichen, aber einige wichtige Unterschiede bleiben. In einem ersten Schritt sollten sich ausländische Unternehmen Klarheit darüber verschaffen, ob und, wenn ja, in welcher Weise sie die neuen chinesischen Anforderungen betreffen.

Reputationsrisiko und öffentliche Wahrnehmung
In den letzten zehn Jahren hat sich die öffentliche Wahrnehmung Chinas, seiner Produkte und einem unternehmerischen Engagement in China verändert. Die Politik und die Medien haben eine kritische Grundhaltung entwickelt, die nur teilweise die Realität spiegelt. China ist die zweitgrößte Industrienation der Welt und produziert Waren, die von wenigen anderen Industrieländern und Standorten in diesen Mengen und Qualitäten, zu diesen Preisen und in dieser Vielfalt hergestellt werden können. Die Verknüpfung Chinas mit der globalen Weltwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten ein Niveau erreicht, das nicht mehr ohne massive Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und das Wohlergehen der globalen Bevölkerung heruntergefahren werden kann. Wie kann sich ein einzelnes Unternehmen den Forderungen der Politik und der Medien stellen? Welche Optionen bestehen, um einer negativen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit entgegenzutreten?
Unternehmensweites Risikomanagement – ein bewährter Lösungsansatz
Es ist unumgänglich, sich einen Überblick über die beschriebenen Risikobereiche zu verschaffen, sachlich, faktenbasiert und objektiv.
Auf Basis einer umfassenden Risikoanalyse ist auf der Ebene der Unternehmensführung zu entscheiden, welche Strategien dem Unternehmen die bestmögliche Ausgangslage verschaffen. Das sollte auf der Basis eines Katalogs bewerteter Risiken geschehen, der Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungspotenzial pro Risiko analysiert. Drohende Gefahren müssen zwischen den einzelnen Risikobeurteilungen durch die Geschäftsführung auf den neuesten Stand gebracht und bei plötzlich veränderten Bedingungen dem Vorstand gemeldet werden. In der Regel erfolgt eine unternehmensweite Risikobeurteilung jährlich, angesichts der aktuellen Lage empfiehlt sich aber eine kürzere Periodizität.
Risiken sind ganzheitlich zu betrachten
Aufgrund der Risikobeurteilung und entlang der folgenden drei Fragen kann die Führung entscheiden, welche Strategien möglich und umsetzbar sind: Welche Investition ergibt wann für wie lange Sinn? Wie hoch ist das Ausfallsrisiko bei welchen Szenarien? Welche Produkte sind wie und wo zu produzieren?
Die Verlagerung der Endmontage eines Produkts von China nach Südostasien beispielsweise kann aus Kostengründen von Vorteil sein. Erfolgt sie aber nur, um die Sicherheit der Lieferkette zu erhöhen, ist zu berücksichtigen, dass die zugrunde liegenden Materialien und Halbfabrikate unter Umständen teilweise weiterhin aus China bezogen werden müssen. Mit einem Wegzug von China geht also die Kontrolle über diesen Teil der Lieferkette zumindest teilweise verloren. Ist ein solches Vorgehen tatsächlich sinnvoll?
Unternehmen sollten rasch reagieren können
Welche Märkte sind für das Unternehmen relevant? China hat eine Bevölkerung, deren Nachfrage enorm ist. Für westliche Unternehmen ist das Land ein attraktiver Markt. Werden die abzusetzenden Produkte in China hergestellt oder importiert? Wie stark sind diese Produktmärkte von der Meinungsbildung der chinesischen Bevölkerung abhängig?
Fazit: Strukturiertes Risikomanagement ist ein Muss
Vieles, was dieser Beitrag anspricht, ist nicht neu. Neu ist die Verkürzung der Reaktionszeit, die einem Unternehmen zur Verfügung steht. Die einzelnen Risikobereiche müssen zueinander in Kontext gesetzt werden, um dem Unternehmen nachvollziehbare Entscheidungen zu ermöglichen. Das Ziel ist, die Risiken in einem Bereich zu halten, in dem das Gesamtunternehmen nicht gefährdet und eine nachhaltige Ertragslage gewährleistet ist. Ein dynamisch aufgesetztes unternehmensweites Risikomanagement ist ein wichtiges Werkzeug für die Geschäftsleitung – Chefsache eben.

Felix Sutter
Felix Sutter, der fast 20 Jahre als Partner bei PricewaterhouseCoopers (PwC) Schweiz tätig war, ist seit 2015 Präsident der Schweizerisch-Chinesischen Handelskammer (SCCC). Er war maßgeblich an der Neupositionierung der SCCC und der Umstrukturierung des Vorstands beteiligt. Im November 2017 wurde er zu einem von drei „Visiting Leaders“ der China European International Business School (CEIBS) Shanghai Campus nominiert. Mit der SUCCEED Consulting GmbH fördern Felix Sutter und sein chinesischer Partner innovative schweizerische und chinesische Unternehmen, indem sie Unternehmer und Investoren zusammenbringen.
Tel.: +41 79 4052785
E-Mail

Stefan Schmid
Stefan Schmid ist Partner von PwC Schweiz und leitet dort die Asia Business Group sowie den Bereich internationale Steuerdienstleistungen. Während seiner knapp 30-jährigen Tätigkeit für PwC war er 1995/1996 auf einem Austausch in New York und 2006 in Shanghai. Zu seinen Kunden gehören vor allem börsennotierte Gruppen aus China, Nordamerika und der Schweiz. Er begleitete verschiedene Schweizer Gruppen bei der Umsetzung ihrer Asienstrategie und chinesische Gruppen beim Aufbau ihrer schweizerischen respektive europäischen Geschäftstätigkeit.
Tel.: +41 58 792 44 82
E-Mail

Philipp Rosenauer
Philipp Rosenauer ist Partner bei PwC Legal Schweiz. In seiner Funktion als Head Legal Function & Legal Strategy Advisory konzentriert er sich auf disruptive Innovationen im Legal-Tech- und Reg-Tech-Markt. Er ist verantwortlich für das Management großer rechtlicher und regulatorischer Projekte. Als Rechtsexperte in der Finanzdienstleistungsbranche unterstützt er Banken, Vermögensverwalter, Händler und Versicherungsgesellschaften bei der Einhaltung der Schweizer und der EU-Finanzvorschriften.
Tel.: +41 58 792 18 56
E-Mail
Interesse geweckt?
Sichern Sie sich die aktuellen Informationen und melden sich an. Als Abonnent der digitalen Ausgabe erhalten Sie dreimal im Jahr ein Informationsupdate.
PwC China Compass
Als Abonnent erfahren Sie, wie Sie Chancen und Gestaltungsspielräume vorausschauend nutzen und Risiken des China-Geschäfts sicher umschiffen.