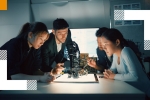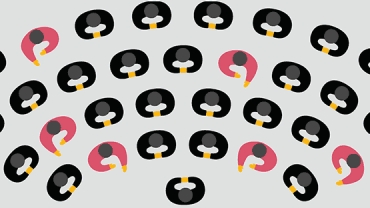Das Vermächtnis der digitalen Transformation
30 November, 2021
Als prägende Pfeiler der deutschen Volkswirtschaft sind der Mittelstand und Familienunternehmen in besonderem Maße von der digitalen Transformation betroffen. Sie stehen einerseits vor der Herausforderung, den massiven Veränderungen in ihren jeweiligen Branchen Rechnung zu tragen. Andererseits spielen sie als Organisationen mit hohem gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein eine zentrale Rolle bei dem Übergang in eine nachhaltige, diverse und ökologisch bedachte digitale Gesellschaft.
Es gilt, innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch wie lässt sich in einer Welt des schnellen Wandels ein generationenübergreifendes Geschäft bewahren und weiterentwickeln? Wir werfen ein Schlaglicht auf die drängendsten Herausforderungen und größten Chancen digital-getriebener Veränderungsprozesse.

Das Wichtigste in 30 Sekunden

- Kernursache der Veränderungsprozesse im Zuge der digitalen Transformation ist nicht die Technologie an sich, sondern die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Digitale Transformation ist eine Kulturfrage.
- Mittelständler und Familienunternehmen sind je nach Ausgangslage unterschiedlich betroffen. Einige müssen sich durch den Wandel in ihrer Branche strategisch völlig neu ausrichten. Andere loten gezielt Innovationen mit neuen technischen Möglichkeiten aus.
- Der Mittelstand tut sich noch schwer damit, in digitalen Ökosystemen zu denken, sich auf Kernfähigkeiten zu fokussieren und Kooperationen zu nutzen – kurz: Es braucht einen zügigen Aufbau digitaler Kompetenz.
- Für die Entwicklung der digitalen Gesellschaft sind Mittelständler und Familienunternehmen prägend. Auch im digitalen Raum stellt sich die Frage der Ausgestaltung unternehmerischer Verantwortung.
Ihr Ansprechpartner

Uwe Rittmann
Leiter Familienunternehmen und Mittelstand
bei PwC Deutschland
E-Mail
Wandel als Normalzustand
Zurückkatapultiert in die Vergangenheit. So fühlt sich heute nicht selten die Nachfolgegeneration, wenn sie in den Familienbetrieb eintritt. In der Maschinenhalle sind die einzelnen Geräte singulär programmiert und gesteuert. Von Vernetzung keine Spur. In der Verwaltung stapeln sich die Akten. Längst läuft noch nicht alles papierlos. Vorhandene elektronische Verwaltungssysteme führen ein Eigenleben in Silos. In den Köpfen vieler Nachfolger:innen formt sich schnell ein umfangreicher Maßnahmenkatalog, wie sich das Geschäft mit digitalen Mitteln modernisieren ließe.
Mit jeder neuen Generation kommt frischer Wind ins Unternehmen. Das ist für sich genommen kein Novum. Doch das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Veränderungsprozesse, denen Unternehmen heute ausgesetzt sind, sind beispiellos. Vieles, was noch vor Kurzem Science Fiction war, erreicht unseren Alltag: Autonom fahrende Fahrzeuge, Operationsroboter in Krankenhäusern und Produktionsmaschinen, die eigenständig ihre Wartungen terminieren. Mobile Endgeräte, Industrie 4.0, Cloud Computing, Big Data und zunehmend auch Künstliche Intelligenz sind nur einige Ausprägungen der digitalen Transformation, die mit weitreichenden Veränderungen verbunden sind – und die bei Generationenwechseln nicht selten zu Konflikten führen. Einerseits eröffnen die Veränderungen große Chancen. So konnten zum Beispiel traditionelle Sensorik-Hersteller in ganz neue Bereiche vorstoßen – vor allem im Kontext der Industrie 4.0 und des aufstrebenden Internets der Dinge, in dessen Zuge auch immer mehr Alltagsgegenstände mit Computer- und Sensorkomponenten ausgestattet werden. Andererseits lösen die Herausforderungen der digitalen Transformation nicht nur Stürme der Begeisterung aus. Gerade für Familienunternehmen stellt sich die Frage:
Wie lässt sich die Stabilität und Langlebigkeit des Geschäfts wahren, wenn der immer mehr an Tempo gewinnende Wandel zum Normalzustand wird?

Technologie ist nicht die Kernursache
Die Frage danach, welche Branchen und Unternehmensbereiche von der digitalen Transformation betroffen sind, lässt sich einfach beantworten: Alle – sei es das Tischler- und Schreinerhandwerk oder das Versicherungswesen, die Personalabteilung oder das Sales-Team. Selbst vermeintlich technologieferne Branchen wie die Landwirtschaft setzen längst massiv auf digitale Technologien und haben sich zu regelrechten High-Tech-Hochburgen entwickelt. Die Frage nach der Hauptursache des Wandels ist kniffliger. Die Technologie allein ist es nicht. Sie ist nur der Mittel zum Zweck.
Getrieben ist der Umbruch vielmehr von einer Transformation der gesamten Wirtschaft. Sie nutzt neue Innovationen, Prozesse und Strukturen, um Produktion, Vertrieb und Verwaltung effektiver zu gestalten – eben mit Hilfe der Digitalisierung. Dieser Umbruch führt wiederum dazu, dass auch Mittelständler die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen müssen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen und bei Innovationen auf Augenhöhe zu bleiben. So sind heute nahezu alle mittelständischen Unternehmen von der Digitalisierung in folgenden Unternehmensbereichen konfrontiert:
- In der Produktion geht es darum, Effizienzgewinne zu realisieren. Forschung und Entwicklung loten aus, wie sich mit den Mitteln der Digitalisierung bestehende Prozesse verbessern lassen.
- In der Verwaltung spielen Softwarelösungen wie ERP- und CRM-Systeme eine zentrale Rolle, um organisatorische Prozesse möglichst effektiv und transparent zu gestalten.
- In der Produktentwicklung eröffnen digitale Technologien neue Chancen, um innovative Produkte zu entwickeln sowie neue Geschäftsmodelle und Vertriebswege zu erschließen – zum Beispiel in Form von „as-a-service“-Angeboten.
Verschiedene Formen des Wandels
Je nach Ausgangssituation fallen Unternehmen im Hinblick auf den Umgang mit der Transformation typischerweise in eine von zwei Klassen. Auf der einen Seite stehen Unternehmen, die sich durch einen technologiegetriebenen Wandel in ihrer Branche strategisch völlig neu ausrichten müssen. So sorgt beispielsweise in der Automobilindustrie der Umstieg von konventionellen Antrieben zum E-Fahrzeug und die aktuell damit einhergehende Computerisierung sämtlicher Komponenten für einen Paradigmenwechsel. Das Auto wird nun als Softwareeinheit verstanden, die auf eine neue Art und Weise mit den Kunden interagiert. Ein weiteres Beispiel ist der Umbruch in der Medienbranche, wo das Printsegment zunehmend durch digitale Formate verdrängt wird. In ihrer extremen Form sorgen solche massiven Veränderungen dafür, dass bestehende Firmen und Geschäftsmodelle ohne eine schnelle Anpassung an die neuen Umstände scheitern. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als Disruption.
Auf der anderen Seite stehen technikaffine Unternehmen, die neue Möglichkeiten der Digitalisierung gezielt nutzen, um Innovationen zu schaffen. Einige von ihnen haben sich schon früh mit digitaler Technologie auseinandergesetzt und konnten sich dadurch einen Vorsprung erarbeiten. Häufig jedoch gehen solche Impulse in Familienunternehmen von der Nachfolgegeneration aus. Hier trifft die Unternehmer-DNA auf das Selbstverständnis der Digital Natives, die den digitalen Raum viel routinierter nutzen und offener für Vernetzungen sind. Unabhängig von der Generation hat die COVID-19 Pandemie die Transformation in nahezu allen Branchen beschleunigt. Sie hat zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit mobilem und vernetztem Arbeiten unweigerlich auf die Agenda der Geschäftsführung gesetzt und auch die massiven Defizite in vielen Bereichen unserer Gesellschaft deutlich gemacht.
Gesunde Skepsis oder gefährlicher Verzug?
„Ob wir die Cloud nutzen? Natürlich nicht. Das ist doch alles nur Spionage!“ So oder ähnlich äußerten sich die CEOs vieler Mittelständler noch vor wenigen Jahren, wenn sie auf die Cloud-Transformation angesprochen wurden. Heute ist dieses Diktum klar revidiert. Auch der Mittelstand hat erkannt, dass die Cloud längst eine Basistechnologie des digitalen Raums ist. Wer sie nicht nutzt, agiert langsamer und handelt sich Wettbewerbsnachteile ein.
Das Cloud-Beispiel zeigt, dass die ursprüngliche Skepsis vor neuen Technologien im Mittelstand weit verbreitet ist. Sie ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits bewahrt sie Unternehmen davor, blind jedem neuen Hype zu folgen. Andererseits verzögert sie die Entwicklung von Innovationen und die Adaption dringend benötigter Technologien, die für die internationale Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sind.
Aktuell fällt es mittelständischen Betrieben und Familienunternehmen im Gegensatz zu Großunternehmen zum Beispiel noch schwer, in Ökosystemen zu denken. Ökosysteme bündeln mehrere Dienste und Leistungen verschiedener Anbieter und schaffen dadurch einen Mehrwert für Endkunden.
Die Teilnahme an Ökosystemen setzt ein neues Rollenverständnis voraus: Man ist ein Rädchen im Getriebe, ein Teil von einer größeren Struktur. Dazu gehört der Wille, sich auf seine Kernfähigkeiten zu konzentrieren und verstärkt mit anderen Marktteilnehmern zusammenzuarbeiten - von Fall zu Fall auch mit Konkurrenten. Diese Kooperationsbereitschaft ist unabdingbar, um in der digitalen Zukunft gut aufgestellt zu sein. Schon jetzt zeichnet die Formierung von Ökosystemen ein Zusammenwachsen verschiedener Branchen ab.

Gesellschaftliche Verantwortung im digitalen Zeitalter
Neben all den geschäftsspezifischen Veränderungen hat die digitale Transformation massive gesellschaftliche Auswirkungen. Auch davon sind Familienunternehmen und Mittelständler stark betroffen. Sie übernehmen nicht nur als Arbeitgeber Verantwortung, sondern engagieren sich darüber hinaus immer wieder für ihre Region – sei es durch die Integration von Flüchtlingen oder durch das Vorleben von gesellschaftlichen Werten wie Inklusion und Diversität.
Doch wie kann unternehmerische Verantwortung in einer digitalen Gesellschaft aussehen? Ein wichtiger Ausgangspunkt ist die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden. Viele Arbeitsfelder verändern sich durch den Einsatz digitaler Technologien. Einige Aufgaben fallen weg, andere kommen hinzu. Die Neugierde für das Neue aufrechtzuerhalten und eine Kultur des lebenslangen Lernens zu fördern, ist eine Kernaufgabe der digitalen Gesellschaft, für die sich Mittelständler und Familienunternehmen künftig noch stärker einsetzen müssen.
Ein Ende der digitalen Transformation ist nicht in Sicht. Mit den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz klopft vielmehr der nächste große Umbruch bereits vehement an die Tür des Mittelstands. So bleibt die Herausforderung der digitalen Transformation nicht auf den Moment beschränkt. Das Vermächtnis der digitalen Transformation wird auch kommende Generationen beschäftigen.
Megatrends der digitalen Transformation
Die digitale Transformation ist ein kontinuierlicher Prozess, der bereits seit mehreren Jahrzenten die Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst. Aktuell gehören folgende Megatrends zu den wichtigsten Ausprägungen:
- Mobile Revolution
- Industrie 4.0
- Cloud Computing
- Künstliche Intelligenz
Mobile Revolution
Fast jeder von uns trägt mindestens einen leistungsstarken Computer in der Hosentasche. Der Durchbruch des Smartphones und weiterer mobiler Endgeräte sorgt dafür, dass der Mensch an allen nur erdenklichen Orten online ist – sei es am Bahnhof, im Ladenlokal oder in der Maschinenhalle. Zielgruppen sind dadurch in völlig neuen Kontexten erreichbar.
Contact us