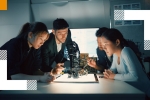Von Kati Fiehler und Jannis Lülf. In unserer Rubrik „Nachgefragt“ greifen wir in Gesprächen mit Unternehmensvertreter:innen, Vertreter:innen der Finanzverwaltung, der OECD sowie Vertreter:innen aus der (internationalen) Beraterschaft die aktuellen Entwicklungen im Bereich Verrechnungspreise auf.
Die verschiedenen Blickwinkel bieten eine ganzheitliche Sicht auf die Herausforderungen und liefern Denkanstöße für die Verrechnungspreispraxis. Für dieses Interview konnten wir Marcus Fischer gewinnen, der aktuell Referatsleiter im Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ist und dort den Bereich Digitale Wirtschaft verantwortet.
Aufbau und Entwicklung des Referats Digitale Wirtschaft
Herr Fischer, Sie sind mittlerweile seit 2018 Referatsleiter im BZSt und verantworten den Bereich Digitale Wirtschaft. Zunächst bedanken wir uns für Ihre Bereitschaft, sich außerhalb Ihrer behördlichen Rolle zu den aktuellen Entwicklungen zu äußern. In gemeinsamen Pod- und Webcasts mit PwC im Jahr 2020 haben Sie über Aufbau und Entwicklung in den ersten drei Jahren des Referats berichtet. Was ist seitdem passiert?
Marcus Fischer: Zunächst einmal geht mein Dank für die Einladung zum Gespräch an Sie zurück.
Wenn ich auf das Jahr 2018 zurückblicke, so muss ich feststellen, dass wir im Referat in Digitalisierungsfragen durch gemeinschaftliches Lernen eine für mich damals nicht vorstellbare Fachkompetenz aufgebaut haben. Der Mehrwert des Referates zeigt sich heute, indem wir mit den gewonnenen Erkenntnissen Wertschöpfungsbeiträge im Rahmen der Digitalisierung besser einordnen können und einen besseren Zugang zu den durch die Digitalisierung beeinflussten Funktionen gefunden haben. Dadurch ist es uns zum Beispiel auch möglich geworden, neue vergütungspflichtige Geschäftsbeziehungen zu erkennen.
Kurz gesagt, wir können unser informatisches Wissen in steuerliche Themen transformieren.
Mit unserer Spezialisierung sind wir Ansprechpartner für den Bund und die Länder geworden. Es ist uns wichtig, unser Wissen zu teilen, zumal wir branchenübergreifend tätig sind und nicht alle Themen von uns in der Fläche betreut werden können.
Digitale Werttreiber in Betriebsprüfungen
Sie unterstützen gemeinsam mit Ihren Betriebsprüfern in einer Art dritten Säule die Landes- und BZSt-Branchenprüfer. Hierbei liegt der Fokus der Prüfungshandlungen auf digitalen Anknüpfungspunkten, die Auswirkungen auf die Verrechnungspreisgestaltung haben könnten, wie immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Daten und Netzwerkeffekte, aber auch Funktionen, die in einer klassischen Funktionsanalyse vielleicht zu wenig Berücksichtigung finden). Was zeigt Ihre Erfahrung: Welche sind die wichtigsten digitalen Werttreiber und was war für Sie die vielleicht größte Überraschung?
Fischer: In unseren Betriebsprüfungen haben digitale Geschäftsmodelle eine besondere Bedeutung. Wenn wir uns mit den Firmen über die Werttreiber der Geschäfte unterhalten, dann werden uns in der Regel Strategie, Nutzer- oder Kundenstamm, Marke, Daten und Technologie/Software genannt. Die Werthaltigkeit der einzelnen Position wird abhängig von In- und Outbound Fällen zum Teil unterschiedlich dargestellt.
Dass die Identifizierung von sämtlichen immateriellen Werten höchst komplex ist und dass Wertschöpfungsbeiträge von Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation (DEMPE)-Funktionen nicht einfach zu ermitteln sind, überrascht mich nicht. Dies bleibt stets eine große Herausforderung in den Betriebsprüfungen.
Überraschend für mich ist jedoch hingegen die Erkenntnis, dass immaterielle Werte nicht immer die alleinigen Werttreiber von digitalen Geschäftsmodellen sind.
Es lohnt sich immer, auch die existierenden Personalfunktionen zu würdigen.
Als Beispiel möchte ich die Tätigkeiten von Data Scientists nennen. Ich sehe persönlich ihre Aktivitäten bei der Erstellung einer Data Pipeline für werthaltiger an als einen von ihnen genutzten statischen Algorithmus.
Herausgabe von Geschäfts-E-Mails in Betriebsprüfungen
Ein sicherlich umstrittenes Thema und Aufhänger für den 2020-er Podcast war die Anforderung der Herausgabe von Geschäfts-E-Mails auf Grundlage des § 147 Abs. 1 Nr. 5 Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 147 Abs. 6 AO. Diese sollen, so die damalige Position, bei der Sachverhaltsaufnahme wichtige Informationen für die Funktions- und Risikoanalyse liefern.
Fischer: Das habe ich auch so wahrgenommen.
Es mag zutreffend sein, dass diese unbekannte Betriebsprüfungsmethode aus Beratersicht kritisch beurteilt wird. Aber bedenken Sie bitte die Implikationen der Digitalisierung in den Unternehmen. Für Kollaborationen werden vermehrt entsprechende Tools genutzt, Schriftverkehr wird immer häufiger durch E-Mail-Kommunikation abgelöst und programmierbare Verträge werden über das Internet bei bestimmten Ereignissen automatisiert ohne physische Präsenz abgeschlossen (Smart Contracts). Auf diese Entwicklungen können altbewährte analoge Prüfungsmethoden nicht immer angemessen angewandt werden. Auch die Finanzverwaltung muss sich notwendigerweise die Digitalisierung zu Nutze machen. Hierbei sind jedoch immer die gesetzlichen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten als Grenze zu beachten.
Seitens Steuerpflichtigen und -beratern bestand die Sorge, dass die Herausgabe nicht mehr im Einklang steht mit den Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen und dem Datenschutz. Hat sich dieses Instrument bewährt und wie bewerten Sie die Kosten-/ Nutzenabwägung heute?
Fischer: Diese Sorge vermag ich nicht zu teilen. Ein mögliches Vorlageverlangen in Betriebsprüfungen beschränkt sich doch nur auf die steuerlich relevante E-Mail-Kommunikation, welche gem. § 147 Abs. 1 Nr. 2, 3, 5 AO zu den aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Unterlagen gehört. So hat auch das Finanzgericht Hamburg mit Urteil vom 23. März 2023, 2 K 172/19 entschieden, dass das Vorlageverlangen in einer Betriebsprüfung nicht die sachlichen Befugnisse aus § 147 Abs. 6 AO überschreitet und demzufolge weder ermessenfehlerhaft ist noch einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz darstellt.
Hierbei ist zu beachten, dass dem Steuerpflichtigen auch ein Recht der Erstqualifikation für den steuerlich relevanten E-Mail-Verkehr zusteht.
Zur Vermeidung von Betriebsprüfungsstreitigkeiten ist zu empfehlen, dass der Steuerpflichtige im Zusammenhang mit der Ausübung dieses Rechts eine Verfahrensdokumentation vorlegen kann und einen sensiblen Umgang mit der Datenlöschung pflegt.
Denn die Finanzbehörde könnte bei konkreten, begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Datenqualifikation mit ihrem sekundären Qualifikationsrecht auch eine Nachbesserung verlangen. Ein letztendlicher Verstoß gegen die Aufzeichnungspflichten mit der Folge einer Schätzungsbefugnis gem. §§ 158, 162 Abs. 2 S. 2 AO für die Finanzverwaltung sollte vermieden werden.
Aus meiner Perspektive ist diese Prüfungsmethode ein effektives Mittel, welches die fortschreitende Digitalisierung in den Unternehmen adaptiert. Sie beinhaltet Chancen für alle Parteien einer Betriebsprüfung. Mit ihr können mit zeitnahen Informationen Verrechnungspreise verifiziert und mit den richtigen Auswertungstools Betriebsprüfungen signifikant beschleunigt werden.
Ein geäußertes Ziel war, gerade bei global umgesetzten Projekten (z. B. im Bereich Forschung und Entwicklung) die Verantwortlichkeiten, Hintergründe usw. besser zu verstehen, um sich von der „Abstraktheit“ der bisherigen Funktionsanalysen abzusetzen. Im Zuge der gesetzlichen Einführung des DEMPE-Konzepts finden vermehrt spezifische Funktions-/ Prozessanalysen Anwendung (z. B. die RACI-Matrix). Stellen derartige Analysen eine bessere Alternative zu der Vorlage und Auswertung von (E-Mail-) Daten in Betriebsprüfungen dar?
Fischer: Aus meiner Sicht gibt es kein Entweder oder. Für jeden Prüfungsfall sollte im Zuge der freien Beweismittelwahl im Sinne des § 92 AO von der Betriebsprüfung abgewogen werden, welche Prüfungsmethode das mildeste Mittel mit den gleichen effektiven Ergebnissen ist.
Jetzt zum Newsletter anmelden
In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter informiert Sie unser internationales Expertenteam über aktuelle Entwicklungen zum Thema Verrechnungspreise.
Zurück zur Artikelübersicht
Newsletter Transfer Pricing Perspectives DACH – Ausgabe 60