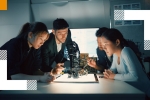Von Jannis Lülf. In unserer Rubrik „Nachgefragt“ greifen wir in Gesprächen mit Fachexpert:innen, Unternehmensvertreter:innen, Vertreter:innen der Finanzverwaltung, der OECD sowie Vertreter:innen aus der (internationalen) Beraterschaft die aktuellen Entwicklungen im Bereich Verrechnungspreise auf. Die verschiedenen Blickwinkel bieten eine ganzheitliche Sicht auf die Herausforderungen und liefern Denkanstöße für die Verrechnungspreispraxis.
Den Bildungsweg und die Karriere von Prof. Dr. Stefan Eymann in all seinen Facetten zu beschreiben, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, daher muss eine Zusammenfassung reichen: Prof. Dr. Stefan Eymann kann auf fast 14 Jahre bei der deutschen Finanzverwaltung zurückblicken, davon 10 Jahre als Bundesbetriebsprüfer für Verrechnungspreise beim BZSt mit tiefgreifenden Erfahrungen in der Durchführung von Verständigungs- und Vorabverständigungsverfahren sowie Joint Audits.
Er publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften und -büchern zu Verrechnungspreisen, insbesondere zu Finanzierungstransaktionen. Er ist Dozent an der Bundesfinanzakademie und hat bereits Lehrveranstaltungen u. a. an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und der Wuhan Business University gehalten. Für ihn beginnt das Jahr 2024 mit gleich zwei neuen Kapiteln in seiner beruflichen Laufbahn. Er folgt einem Ruf der Leibniz-Fachhochschule und übernimmt eine Professur für allgemeine BWL, insb. Steuerlehre und Rechnungslegung. Zudem bringt er seine Fachkenntnisse seit dem Jahreswechsel als Of-Counsel für Verrechnungspreise im PwC-Verrechnungspreisteam ein.
Wechsel von Finanzverwaltung zu freier Wirtschaft
Mit Deiner neuen Rolle bei PwC vollziehst Du einen in Deutschland weiterhin ungewöhnlichen Schritt: Einen Wechsel zwischen Finanzverwaltung und freier Wirtschaft. In anderen Ländern wie Frankreich und den Niederlanden ist ein solcher Wechsel in beide Richtungen – und zum Teil sogar wieder zurück – ein viel normalerer. Woran liegt das und welchen Wert kann ein derartiger Wissensaustausch haben, für die Verwaltung wie für die Steuerpflichtigen?
Stefan Eymann: Es ist aus meiner Sicht der Dinge viel zu selten, dass Bedienstete aus der Finanzverwaltung in die Beratung oder freie Wirtschaft wechseln. Den Erfahrungsschatz, den man in der jeweiligen Tätigkeit, sei es in der Finanzverwaltung oder in der Beratung bzw. freien Wirtschaft, aufgebaut hat, kann man sehr gewinnbringend jeweils auch mal anders einbringen. Ich rede bewusst nicht von der „Gegenseite“. Natürlich vertrat ich vorher die Interessen des Fiskus, nunmehr vertrete ich die Interessen des Mandanten.
Gleichwohl ist es unser aller Ziel, dass dem Land, in dem wir leben und arbeiten, das faire und angemessene Steuersubstrat zugerechnet wird. Es geht also um das gemeinsame Ziel, nach unserer Beratung das steuerlich angemessene Substrat in Deutschland zu erklären.
Meinen Tätigkeitsschwerpunkt sehe ich auch in der vermittelnden Rolle komplexer Sachverhalte zwischen dem Mandanten und der Finanzverwaltung. Die eher juristische Sichtweise der Finanzverwaltung soll mit der auch ökonomischen Sichtweise der Verrechnungspreise zusammengeführt werden.
Im optimalen Fall werden tragfähige Kompromisse gefunden, die das ökonomische Abbild des Konzerngewinns, und dessen weltweite Verteilung, zutreffend darstellen.
Während Deiner Karriere als Bundesbetriebsprüfer, mit beruflichen Abstechern nach Italien und UK, hast Du eine Vielzahl von Joint Audits und APAs betreut. Die letzten Statistiken zeigen, dass in 2022 die Anzahl der in Deutschland in EU-Fällen neu beantragten Verständigungsverfahren (161) um mehr als das Vierfache höher liegt als die Anzahl der Vorabverständigungsverfahren (38). Warum schöpfen die Steuerpflichtigen die vorhandenen Möglichkeiten zur Schaffung bi- bis multilateraler Rechtssicherheit vor Eintritt einer Doppelbesteuerung nicht aus?
Eymann: Dafür gibt es leider viele Gründe. Wer mich zu seinen Fällen dazu holt, dem sage ich immer: Die Streitvermeidung ist besser als die Streitbeilegung. APAs sind eine sehr gute Sache, dem Grunde nach.
APAs sind effizient und tragen zu einer modernen Betriebsprüfung bei, die dann schneller vorüber ist. Die Bearbeitung solcher APA dauert in Deutschland derzeit noch recht lange. Nicht selten erlebte ich, dass APAs selbst bei Steuerpflichtigen, die gut mitwirkten, länger dauerten, was allerdings auch der Komplexität zugeschrieben werden muss. Gerade bei diesen APA-Verfahren bin ich zuversichtlich, dass regelmäßige Jour-Fixe-Termine mit der Finanzverwaltung zu einem effizienteren Verfahren beitragen werden.
Einen Aspekt möchte ich noch erwähnen: Meine Erfahrung zeigt, dass in APA-Verfahren ein besseres „Miteinander“ herrscht. Die Verständigungsverfahren sind, so mein eigener Terminus, „Konfrontationsverfahren“, also entstanden durch Meinungsverschiedenheiten bei bereits realisierter Doppelbesteuerung. Im Ergebnis kann ich APAs durchaus empfehlen, da Konflikte in der Besteuerung der Wertschöpfung vorgezogen diskutiert werden. Zudem gilt, dass, wenn ein APA besteht, und sich der Sachverhalt nicht wesentlich änderte, einfach ein Verlängerungsantrag gestellt werden kann. Diese Anträge zur Verlängerung eines APAs sind zumeist wesentlich zügiger abgeschlossen.
Die größten Herausforderungen für den deutschen Steuerpflichtigen
Auch hast Du auf Ebene der OECD an der Entwicklung zu Chapter X der OECD-Leitlinien zu Finanzierungstransaktionen mitgewirkt. Bei den Steuerpflichtigen bereitet der Balanceakt zwischen deutscher Verwaltungspraxis, BFH-Rechtsprechung und OECD-Leitlinien regelmäßig Kopfzerbrechen. Begleitet wird dieser Themenkomplex von viel Literatur, nicht zuletzt auch in Form Deiner Doktorarbeit. Wo siehst du in diesem Spannungsfeld die größten Herausforderungen für den deutschen Steuerpflichtigen?
Eymann: Die OECD-Leitlinien, insbesondere das Chapter X, diskutierte ich in vielen internationalen Projekten auf Arbeitsebene. Insbesondere bei FISCALIS in Wien stellte ich mehrfach Fälle und Diskrepanzen vor. Der BFH hat in unterschiedlichen Entscheidungen zu Finanztransaktionen im Jahr 2021 (u. a. Urt. v. 18.5.2021 – I R 62/17) sogar auf die OECD-Leitlinien verwiesen, so wie es auch neuerdings die Finanzverwaltung als Anhang zu manchen BMF-Schreiben macht. Das eine ist also der Anhang und das andere ist dann doch wieder die eigene Regelung im vorderen Teil des BFH-Urteils und der Verwaltungsregelung. Die Richtung zum globalen Denken stimmt dahingehend, dass wir international argumentieren müssen. Allerdings fällt es dem BFH und der Verwaltung anscheinend generell doch schwer, das eine oder andere nicht selbst in die Hand zu nehmen, und schon haben wir wieder eine nationale Sonderregelung.
Die Anwendung des Preisvergleiches ist wohl akzeptiert. Das Heranziehen geeigneter Corporate Bonds als Referenzwert wird belastbar sein. Streitig sind die Ratings an sich. So wird bspw. streitbehaftet sein, ob die Anwendung des Konzernratings vs. des Stand-Alone-Ratings zutreffend ist. Dabei wird der Fall im Sachverhalt gewonnen. Wir müssen im Sachverhalt stark sein und Diskrepanzen (Besonderheiten) herausarbeiten, die zu anderen Schlussfolgerungen führen können.
Die Herausforderung liegt in der Offenheit zwischen Mandanten und Beratern. Dabei gilt es, offen zu kommunizieren und den Sachverhalt klar und eindeutig darzustellen. Dann ist auch eine steuerlich tragfähige Beratung möglich.
Im Rahmen des Wachstumschancengesetzes war zunächst die Einführung einer Zinshöhenschranke vorgesehen. Gegen Ende letzten Jahres wurde diese überraschend wieder herausgenommen. Die nunmehr stattfindende Anpassung der Verrechnungspreisregeln für Finanzierungsbeziehungen in §1 Abs. 3d und 3e AStG sieht zum einen eine Begrenzung des Zinsabzugs auf den Gruppenzinssatz vor sowie zum anderen eine Regelung, wonach die Vermittlung bzw. Weiterleitung von Finanzmitteln im Grundsatz als funktions- und risikolose Dienstleistung anzusehen ist. Wie hast Du diese Diskussion und das Für und Wider wahrgenommen?
Eymann: Die Diskussion ist in der Sache nicht neu. Wir erinnern uns alle an die Diskussionen Ende 2019/Beginn 2020 im Rahmen des ATAD-Umsetzungsgesetzes. Seinerzeit hätte der § 1a AStG-E das vorstehende regeln sollen. Befürwortend könnte sein, dass es nunmehr eine Regelung gibt, sofern diese auch tatsächlich verabschiedet wird. Da die Länder nunmehr mehr involviert waren, sollten die Verrechnungspreisregeln für Finanzierungsbeziehungen in §1 Abs. 3d und 3e AStG nunmehr auch den Bundesrat passieren.
Kritisch sehe ich den apodiktischen Regelungsinhalt. Per se zu unterstellen, die Konzernfinanzierung ist eine reine Hülle, ist aus fiskalischer Sicht in Ordnung, wenn es sachliche und vor allem ökonomische Gründe dafür gibt. Der Zinssatz muss einerseits das ökonomische Abbild des Konzerns darstellen. Andererseits muss der Zinssatz auch ökonomisch im Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz stehen sowie transaktionsbezogen und kritikbasierend abgeleitet sein. Versteckt will der Gesetzgeber wohl auch das Konzernrating in den Adelsstand heben. Es scheint, als sei die Reputation des Konzernratings, aus Sicht des Gesetzgebers, wesentlich besser als die des Stand-Alone-Ratings. Das ist meines Erachtens eine Pauschalierung zu Lasten der ökonomischen Betrachtungsweise und substantiierten Ableitung eines Zinssatzes der rechtlichen Einheit.
Der BFH forderte im Jahr 2021 (Urt. v. 18.5.2021 - I R 62/17) zu Recht, dass der Zinssatz ökonomisch zu ermitteln ist. Dies beinhaltet meines Erachtens auch das Erstellen eines Stand-Alone-Ratings und eine ökonomische Justierung zum Konzernrating hin. Dies schlug ich bereits in meiner Zeit als Bundesbetriebsprüfer 2021 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Die Unternehmensbesteuerung“ (Eymann, Ubg 2021, S. 157-175) vor.
Hot Topics des letzten Jahres
Was waren aus Deiner Sicht die Hot Topics in den von Dir im letzten Jahr begleiteten Betriebsprüfungen?
Eymann: Hot Topics sind zunehmend die Themen Konzernfinanzierung und das Cash-Pooling. Meine Dissertation begann ich 2019 genau mit diesem Thema, woraus sich erfreulicherweise Synergien für mich ergaben. Den Trend, die Konzernfinanzierung und das Cash Pooling in den Fokus der Betriebsprüfung zu rücken erkennt man auch an den Regelungen in den aktuellen Verwaltungsgrundsätzen Verrechnungspreise sowie den OECD-Leitlinien 2022. Neue Sichtweisen waren dabei u. a. das eigene Kapitel für das Cash-Pooling, der Risikokontrollansatz, die Bestimmung der risikofreien Rendite und die Rechtsprechung des BFH (Urt. v. 18.05.2021, I R 4/17), die zum Teil eine andere Rechtsauffassung in dem Leistungsgefüge bei Konzerndarlehen sah als die Finanzverwaltung.
Eher konservative und vor allem formale Themen, wie die Verwertbarkeit der Dokumentation, sind seltener im Fokus der Betriebsprüfung, da mittlerweile die Steuerpflichtigen in der Regel verwertbare Verrechnungspreisdokumentationen iSd § 90 Abs. 3 AO vorlegen. Hier hat sich eine regelgerechte Praxis herausgebildet. Für mich sind in diesem Zusammenhang generelle Highlights der finale Steuerausfall bzw. die finale Steuerverschiebung gewesen, wie dies bei Verrechnungspreisen generell der Fall ist.
In Bezug auf den internationalen Austausch war ein multinationales Joint Audit das Highlight in den letzten 12 Monaten, welches zwischen Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien stattfand. Erfahrungsaustausche zur gesamten Wertschöpfungskette waren dadurch multinational u. a. mit Italien bei der „Guardia di Finanza“ (Rom), in Belgien bei der „Tax Conciliation Department“ (Brüssel) und in Großbritannien bei „His Majesty’s Revenue and Customs“ (Edinburgh) möglich.
Neuberufener Professor und eine Rolle als anerkannter Fachexperte in der Beratung. Welche weiteren beruflichen Ziele kann man da noch haben?
Eymann: Ziele sind wichtig im Leben. Vor allem müssen wir in der Wissenschaft und in der Praxis fit und modern bleiben. Heute aktuelles ist vielleicht morgen schon „Schnee von gestern“. Ich lebe nach dem Aphorismus, welches Philip Rosenthal (zuvor in englischer Sprache Oliver Cromwell) zugeschrieben wird: „Wenn wir aufhören, besser werden zu wollen, können wir nicht weiter gut sein.“
Mein Ziel ist und bleibt es, eine sehr gute Lehre der wissenschaftlichen Theorie mit einer bewährten Praxis zu kombinieren, was die Forschung an der Leibniz-Fachhochschule in Hannover angeht. Bezüglich meiner praktischen Fachexpertise freue ich mich, den Tax-Compliance-Gedanken umsetzen zu können.
Im Ergebnis ist mein generelles Ziel nur allzu menschlich: Ich freue mich, wenn meine wissenschaftliche und praktische Expertise in der Sache gebraucht wird und für alle Beteiligten gewinnbringend eingebracht werden kann.
Lieber Stefan, wir danken Dir sehr für das Interview und Deine Zeit!
Jetzt zum Newsletter anmelden
In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter informiert Sie unser internationales Expertenteam über aktuelle Entwicklungen zum Thema Verrechnungspreise.
Zurück zur Artikelübersicht
Newsletter Transfer Pricing Perspectives DACH – Ausgabe 61