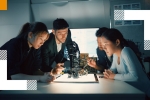Von Dr. Anne-Kathrin Barth und Gerrit Halbach. Die sog. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die am 5. Januar 2023 in Kraft getreten ist, stellt eine bedeutende Änderung der Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der EU dar. Ziel dieser Richtlinie ist es, die Transparenz und Vergleichbarkeit der von Unternehmen gemeldeten Sozial- und Umweltinformationen zu verbessern.
Der Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird zudem stufenweise auf mehr Unternehmen, einschließlich großer kapitalmarktorientierter Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie bestimmte Tochterunternehmen von Unternehmen außerhalb der EU erweitert. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet diese Richtline bis zum 6. Juli 2024 lokal umzusetzen.
Bisherige Umsetzung in Deutschland
Für Deutschland liegt aktuell nur ein Regierungsentwurf vom 24. Juli 2024 des Bundesministeriums der Justiz vor. Dieser folgt nach eigener Aussage exakt der EU-Richtlinie und sieht eine etappenweise Einführung zwischen 2024 bis 2028 vor. Ab dem Geschäftsjahr 2024 müssen zunächst alle bisher berichtspflichtigen Unternehmen und Konzernunternehmen von bilanzrechtlich großen Unternehmensgruppen, die mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigen, die Anforderungen erfüllen. Im darauffolgenden Jahr, ab 2025, werden alle anderen bilanzrechtlich großen Unternehmen einbezogen. Ab 2026 erweitert sich der Anwendungsbereich auf kapitalmarktorientierte KMU, wobei diese die Möglichkeit haben, die Umsetzung bis 2028 aufzuschieben. Ab 2028 müssen dann auch EU-Tochterunternehmen und EU-Zweigniederlassungen von Drittstaatskonzernen den Berichtspflichten nachkommen.
Bestandteile der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Gemäß der EU-Richtlinie müssen folgende Informationen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß CSRD enthalten sein:
- Kurze Beschreibung des Geschäftsmodells und der Strategie, einschließlich der Widerstandsfähigkeit;
- Gesetzte Ziele des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit und Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele;
- Die Rolle der Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane;
- Richtlinien zur Nachhaltigkeit;
- Wichtigste Risiken und Abhängigkeiten und das Verwalten dieser Risiken;
- Relevante Indikatoren für die Offenlegung der in den Punkten 1. bis 5. genannten Informationen sowie die Angaben der „grünen“ Taxonomie der EU;
- Immaterielle Werte: intellektuelles, menschliches, soziales und Beziehungskapital;
- Verfahren zur Ermittlung der im Lagebericht enthaltenen Informationen unter Berücksichtigung des kurz-, mittel- und langfristigen Horizonts und
- Due-Diligence-Prozess und die wichtigsten negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Wertschöpfungskette.
Schnittstellen zu Verrechnungspreisen
Die genannten Anforderungen, insbesondere die Punkte 1.,5.,7. sowie 9. haben Überlappungen zu Verrechnungspreisthemen, allen voran zu den bestehenden Dokumentationsverpflichtungen, d. h. Master File, Local File und Country-by-Country Reporting (CbCR). Zudem besteht eine Verbindung zu den erforderlichen Angaben im ab 2025 abzugebenden sog. Public CbCR.
Die folgende Tabelle stellt eine Übersicht über mögliche Überschneidungen zu den genannten Punkten dar:
| CSRD | Local File (gem. § 4 GAufZV) |
Master File (gem. Anlage zu § 5 GAufzV) |
CbCR (gem. § 138a AO) |
Public CbCR (gem. § 342h HGB) |
| 1. Kurze Beschreibung des Geschäftsmodells und der Strategie, einschließlich der Widerstandsfähigkeit | § 4 (1) Nr. 1: Allgemeine Informationen über die Beteiligungsverhältnisse, den Geschäftsbetrieb und den Organisationsaufbau
§ 4 (1) Nr. 1.e): Die Beschreibung der Geschäftsstrategie zu Beginn sowie die Beschreibung der Veränderungen der Geschäftsstrategie innerhalb des Prüfungszeitraums |
Nr. 1: Grafische Darstellung des Organisationsaufbaus (Rechts- und Eigentümerstruktur) sowie der geografischen Verteilung der Gesellschaften und Betriebsstätten, die zur Unternehmensgruppe gehören | § 138a (2) Nr. 1: Eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Übersicht, wie sich die Geschäftstätigkeit des Konzerns auf die Steuerhoheitsgebiete verteilt, in denen der Konzern durch Unternehmen oder Betriebsstätten tätig ist | § 342h (2) Nr. 1 HGB: Eine kurze Beschreibung der Art der Geschäftstätigkeiten im Berichtszeitraum |
| 2. Gesetzte Ziele des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit und Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele | Nr. 2: Übersicht über bedeutende Faktoren für den Gesamtgewinn der Unternehmensgruppe | |||
| 3. Die Rolle der Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane | § 4 (1) Nr. 1.d): Die Beschreibung der Managementstruktur sowie der Organisationsstruktur des inländischen Unternehmens des Steuerpflichtigen | |||
| 4. Richtlinien zur Nachhaltigkeit | ||||
| 5. Wichtigste Risiken und Abhängigkeiten und das Verwalten dieser Risiken | § 4 (1) Nr. 3: Funktions- und Risikoanalyse: Informationen über die im Rahmen der Geschäftsbeziehungen übernommenen Risiken | Nr. 6: Zusammenfassende Funktionsanalyse, die die Hauptbeiträge beschreibt, die die einzelnen Unternehmen der Unternehmensgruppe zur Wertschöpfung leisten, das heißt die ausgeübten Schlüsselfunktionen, die wichtigen übernommenen Risiken und die wichtigen genutzten Vermögenswerte | ||
| 6. Relevante Indikatoren für die Offenlegung der in den Punkten 1. bis 5. genannten Informationen sowie die Angaben der „grünen“ Taxonomie der EU | Nr. 13: Allgemeine Beschreibung, wie die Unternehmensgruppe finanziert wird, einschließlich der Darstellung bedeutender Finanzierungsbeziehungen zu fremden Dritten | |||
| 7. Immaterielle Werte: Intellektuelles, menschliches, soziales und Beziehungskapital | § 4 (1) Nr. 2.b): Die Auflistung der wesentlichen immateriellen Werte, die dem Steuerpflichtigen gehören und die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehungen nutzt oder zur Nutzung überlässt | Nr. 8: Allgemeine Beschreibung der Gesamtstrategie der Unternehmensgruppe für immaterielle Werte (Entwicklung, Eigentum, Schutz und Verwertung), einschließlich einer Auflistung der Standorte der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und der Standorte des Forschungs- und Entwicklungsmanagements
Nr. 9: Auflistung der immateriellen Werte oder der Gruppen immaterieller Werte der Unternehmensgruppe, die für die Verrechnungspreisbestimmung von Bedeutung sind, sowie der Unternehmen, die rechtliche Eigentümer oder Inhaber dieser immateriellen Werte sind
Nr. 12: Allgemeine Beschreibung aller wichtigen Übertragungen von Rechten an immateriellen Werten zwischen den Unternehmen der Unternehmensgruppe während des betreffenden Wirtschaftsjahres, einschließlich der entsprechenden Unternehmen, Staaten und Vergütungen |
||
| 8. Verfahren zur Ermittlung der im Lagebericht enthaltenen Informationen unter Berücksichtigung des kurz-, mittel- und langfristigen Horizonts | ||||
| 9. Due-Diligence-Prozess und die wichtigsten negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Wertschöpfungskette | Nr. 7: Zusammenfassende Beschreibung bedeutender, während des Wirtschaftsjahres erfolgter Umstrukturierungen der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe sowie eine Auflistung und zusammenfassende Beschreibung der von der Unternehmensgruppe während des Wirtschaftsjahres vorgenommenen bedeutender Unternehmenskäufe und -verkäufe |
Fazit und Ausblick
Der Steuerpflichtige sollte bei der Erstellung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie relevanter Verrechnungspreisdokumente eine zwingende Konsistenzprüfung der Beschreibungen der Geschäftsmodelle, Unternehmensstrategien, Funktionen, Chancen, Risiken und Vermögenswerte in allen relevanten Unterlagen durchführen. Dabei kann neben der Konsistenz auch ein effizientes Vorgehen durch Nutzung von bestehenden relevanten Ausführungen im Kontext der vorgenannten Verrechnungspreisdokumente sichergestellt werden. Eine Abweichung zwischen dem öffentlich verfügbaren Nachhaltigkeitsbericht sowie den Verrechnungspreisunterlagen (inklusive Public CbCR) könnte zu Rückfragen seitens Betriebsprüfungen führen. Daher empfehlen wir eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der erstmaligen Erstellung des neuen Nachhaltigkeitsberichts.
Jetzt zum Newsletter anmelden
In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter informiert Sie unser internationales Expertenteam über aktuelle Entwicklungen zum Thema Verrechnungspreise.
Zurück zur Artikelübersicht
Newsletter Transfer Pricing Perspectives DACH – Ausgabe 63