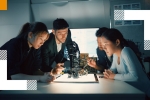Ranking digitalste Städte Deutschlands
17 Mai, 2015
Für die Städte, Gemeinden und Landkreise Deutschlands führt an der Digitalisierung kein Weg vorbei. Neue Technologien ermöglichen bereits heute eine effizientere Verwaltung und helfen dabei die Kosten zu senken. Sie versprechen auch, die Bürger besser zu informieren und verstärkt in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einzubinden. Eine strategische und konsequente Digitalisierung erscheint als das Mittel, um den großen Herausforderungen der Kommunen zu begegnen. Noch haben nicht alle Kommunen damit begonnen, sich auf den Weg in die digitale Zukunft zu machen. Der digitale Graben zwischen den erfolgreichen, digitalen und den analogen Kommunen, droht sich weiter zu vertiefen.
Standortfaktor Digitalisierung
Die Top-10-Städte unserer Rankings verfügen durchschnittlich über deutlich bessere Kennzahlen als die übrigen Städte. In den Top-10-Städten werden mehr Gewerbe angemeldet, sie können ein höheres Gewerbesteueraufkommen erzielen und die Zahl der Beschäftigten wächst schneller. Digitale Städte ziehen neue Einwohner an und es leben mehr Hochqualifizierte in ihnen. Weitere Informationen zum Ranking erhalten Sie hier:
- Augsburg
- Bielefeld
- Bochum
- Bremen
- Dortmund
- Duisburg
- Essen
- Frankfurt am Main
- Gelsenkirchen
- Hannover
- Karlsruhe
- Mannheim
- Münster
- Wiesbaden
- Nürnberg
- 1Köln
- 2Hamburg
- 3München
- 4Bonn
- 5Düsseldorf
- 6Leipzig
- 7Berlin
- 8Wuppertal
- 9Dresden
- 10Stuttgart
Das Problem: kaum klare Strategien
In Sachen Digitalisierung hapert es in den Kommunen oft an der Umsetzung, da klare Ziele und integrierte Konzepte kaum vorhanden sind. Als ein eigenständiger strategischer Sachbereich von herausragender Bedeutung für die Gesamtentwicklung der Kommune wird Digitalisierung von den Kommunen oft jedoch nicht verstanden. Würde die Digitalisierung als strategische Aufgabe begriffen und entsprechend koordiniert, könnten die bislang oft nebeneinander betriebenen Anstrengungen zur Digitalisierung gebündelt und enger verzahnt werden.
Online-Services und Breitbandversorgung ausbaufähig
Digitale Strukturen und Services sind in der Mehrzahl der Kommunen in Deutschland heute nur vorhanden, wo sie mit vergleichbar geringem Aufwand etabliert werden können. Je differenzierter und komplexer die Dienstleistungen einer Stadt jedoch werden, desto seltener werden sie online angeboten. Ein wesentliches Hindernis bei der Digitalisierung der Kommunen in Deutschland ist nach wie vor der schleppende und lückenhafte Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandnetzes. Der sogenannte Ausbaukorridor der Bundesregierung, an dem sich viele Städte orientieren, gilt heute bereits als nicht ausreichende Zielvorgabe. Nur zwei der im Ranking untersuchten Städte haben die Bedeutung eines leistungsfähigen Netzes erkannt und übertreffen bereits die Ziele der Bundesregierung.
Fehlende Mittel und rechtliche Hindernisse behindern die Digitalisierung
Die wesentlichen Hindernisse bei der Digitalisierung der Städte und Gemeinden Deutschlands sind finanzieller, rechtlicher und kultureller Natur. Notwendige Investitionen in die Digitalisierung und damit der Zukunftsfähigkeit der Städte scheitern zu oft an der prekären kommunalen Haushaltslage. Ohne dass heute zusätzliches und qualifiziertes Personal eingestellt wird, kann die Digitalisierung in den Kommunen kaum vorangetrieben werden – auch wenn auf lange Sicht Einsparungen zu erwarten sind. Weil die notwendigen finanziellen Mittel fehlen, kommt auch der Ausbau der technischen Infrastruktur (v. a. Breitband) nicht voran. Als Hindernis für eine erfolgreiche Digitalisierung der Kommunen geben die Befragten außerdem unklare rechtliche Rahmenbedingungen an. Nur unzureichend sind etwa die Folgen vollkommen neuer Prozessabläufe berücksichtigt, die sich durch eine Digitalisierung der Verwaltung ergeben. Auch wichtige Fragen des Datenschutzes sind ungeklärt. In der digitalen Agenda der Bundesregierung ist eine Verbesserung in Aussicht gestellt.
Digitalisierung verstärkt die Polarisierung zwischen den Kommunen weiter
Unsere Umfrage unter 209 Städten, Gemeinden und Landkreisen zeigt, dass die Polarisierung zwischen den Kommunen auch beim Digitalisierungsfortschritt sichtbar wird. In allen Bereichen der Digitalisierung liegen die wachsenden Kommunen vorn bzw. sind wesentlich weiter fortgeschritten als die schrumpfenden Kommunen. Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Kommunen wird sich deshalb auch an ihrer Befähigung und Bereitschaft entscheiden, sich den Herausforderungen der digitalen Gesellschaft zu stellen.

Unsere Handlungsempfehlungen
Die Kommunen haben längst erkannt: Neue digitale Technologien helfen ihnen dabei, effizienter, moderner und attraktiver für Bürger und Unternehmen zu werden. Viele der bisherigen Anstrengungen sind aber isolierte Lösungen. Die Zusammenarbeit über Amtsgrenzen, Stadt- und Kreisgrenzen hinweg muss weiter verstärkt werden. Und es fehlt allzu oft eine strategische Steuerung der vielfältigen Ansätze. Mit den folgenden zehn Handlungsempfehlungen wollen wir dazu beitragen, die Digitalisierung in Deutschlands Städten, Gemeinden und Landkreisen voranzubringen:
1. Kommunen brauchen eine digitale Strategie
Kommunen brauchen eine digitale Strategie – Festlegung klarer Ziele ermöglicht die Durchführung der richtigen Projekte.
Elementar für das Treffen der richtigen Entscheidungen ist die Festlegung von Zielen und die Entwicklung einer auf diesen Zielen aufbauenden digitalen Strategie. Ein Digitalisierungsprozess ist ohne Strategie zwar denkbar, doch werden dabei weder Ressourcen gespart noch die richtigen Projekte durchgeführt. Dies birgt die Gefahr des „Verzettelns“ und steht im Widerspruch zu einer notwendigen ganzheitlichen Herangehensweise bei dem Querschnittsthema Digitalisierung.
2. Digitalisierung ist Chefsache
Digitalisierung ist Chefsache – Digitalisierung als Querschnittsaufgabe muss vom Bürgermeister oder Landrat getrieben sein.
Der (Ober-)Bürgermeister oder Landrat fungiert auf dem Weg zur digitalen Stadt als treibende Kraft. Als Leiter der Verwaltung kann nur er den Veränderungsprozess in seiner Organisation, aber auch in der Stadtgesellschaft in Gang setzen und nachhaltig am Laufen halten. Der Antrieb der Kommune und damit auch der Startschuss zu Veränderungsprozessen und Projekten muss Chefsache sein.
3. Chief Digital Officer einführen
Chief Digital Officer einführen – Bündelung von Kompetenzen in einer schlagkräftigen Funktion für die erfolgreiche und ganzheitliche Umsetzung.
Digitalisierung benötigt einen „Kümmerer“. Im Rahmen der Umstrukturierung und Neudefinition von digitalen Prozessen sollten Kommunen zur Steuerung, Überwachung und Entwicklung die Aufgaben eines Chief Digital Officer (CDO) personell verankern. Der CDO koordiniert bereichsübergreifend Digitalisierungsprojekte und sorgt für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie zur Erreichung der Ziele.
4. Digitale Kultur schaffen
Digitale Kultur schaffen – Steuerung des Veränderungsprozesses durch ein ganzheitliches, transparentes Change Management.
Für einen dynamischen Umgang mit Innovationen und dem digitalen Veränderungsprozess, muss eine gemeinsame digitale Kultur entwickelt werden, welche durch ein ganzheitliches Change Management begleitet wird. Hierzu gehören insbesondere Schulungs- und Informationsprogramme, die Festlegung von Standards sowie auf diesen basierende Werkzeuge, wie Verwaltungssoftware und Datenbanken. Ebenso sind die Förderung des Know-hows und die Weiterbildung des Verwaltungspersonals zu Multiplikatoren im Digitalisierungsprozess elementar. Digitalisierungsprojekte scheitern heutzutage nur selten an den technischen Möglichkeiten, sondern zumeist an der organisatorischen, operativen Umsetzung. Digitalisierung muss gelebt werden.
5. Voneinander lernen
Voneinander lernen – Schaffung einer inter- und intrakommunalen Kommunikationsplattform zur Nutzung von Synergien.
Digitalisierung ist ein Thema, bei dem das soziale Netzwerken zu oft vernachlässigt wird. Mitarbeiter der Stadt, Bürger, Unternehmen und andere Städte können jedoch durch eine verstärkte Zusammenarbeit Synergien heben und gemeinsam neue erfolgsversprechende Ideen zur Digitalisierung entwickeln.
6. Ausschöpfen von Skalenerträgen
Skaleneffekte ausschöpfen – Einführung von Systembaukästen und „Systemsharing“ statt individuellen Insellösungen.
Die Digitalisierung geht mit einer zunehmenden Vernetzung von Daten einher. Für die Vernetzung der Daten ist ein zentrales und standardisiertes System erforderlich. Durch „Systemsharing“ können Synergieeffekte gehoben werden. Kooperationen sind deshalb nicht nur interkommunal, sondern auch mit anderen Unternehmen, Bürgern oder Hochschulen denkbar. Anstelle von Insellösungen, ist die Entwicklung eines Systembaukastens, der Standardlösungen auch flächendeckend für alle Kommunen beinhaltet, wünschenswert. Weiterhin ist die Anpassung des öffentlichen Vergaberechts elementar. Der Trend muss dahin gehen, dass Kommunen ausgehend von ihrem eigentlichen Problem ausschreiben und sich die geeignete Lösung liefern lassen.
7. Nutzer in den Mittelpunkt stellen
Nutzer in den Mittelpunkt stellen – Nutzerorientierung und Benutzerfreundlichkeit fördern die Akzeptanz und vereinfachte Umsetzung der Digitalisierung.
Um den Bürgern den Zugang zum Digitalisierungsprozess zu erleichtern, sind die nach außen orientierten Angebote der Kommunen, wie zum Beispiel Online-Bürgerservices, benutzerfreundlich aufzubauen. Dies sollte eigentlich Standard sein, wird durch die 1:1 Digitalisierung analoger Prozesse jedoch oft vernachlässigt. Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Bürger auch weiterhin über die klassischen Kanäle mit der Verwaltung kommunizieren können. Gleichzeitig sind internetaffine Bürger für Digitalisierungsangebote zu begeistern. Dies funktioniert am besten durch ihre Benutzerfreundlichkeit. Digitalisierung kann nur erfolgreich sein, wenn es Prozesse für den Anwender vereinfacht und effizienter macht. Auch die nach innen gerichtete Digitalisierung der kommunalen Verwaltung, sollte nutzerorientiert erfolgen.
Hierfür sind die Nutzeranforderungen zu klären und Soft- sowie Hardware anforderungsgerecht zu gestalten.
8. Finanzierungslücken aufzeigen
Um einer weiteren Polarisierung deutscher Kommunen entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass Kommunen gegenüber Bund und Ländern ihren politischen Einfluss geltend machen und dabei ihre Finanzierungslücken in der Digitalisierung aufzeigen. Damit Bund und Länder bei der Unterstützung eines Digitalisierungsprozesses stärker in die Verantwortung genommen werden, muss Digitalisierung als kommunale Pflichtaufgabe definiert werden.
9. Mut zur Glasfaser
Mut zur Glasfaser – Glasfaser als „winning qualification“ zur Zukunftsfähigkeit einer Kommune.
Die Zukunft gehört laut den Experten der Glasfaser, denn nur Glasfasernetze können mit voranschreitender Digitalisierung die ausreichende Versorgung garantieren. Angesichts des exponentiellen Wachstums des Datenvolums sowohl bei Bürgern als auch Unternehmen ist der Glasfaserausbau eine Grundvoraussetzung für die zukünftige Leistungsfähigkeit und die Attraktivität der kommunalen Infrastruktur.
10. Tue Gutes – und rede darüber
Tue Gutes – und rede darüber – Kommunen als Wegweiser der Zukunft durch innovative und dennoch alltagstaugliche Leuchtturmprojekte.
Die Umsetzung von Leuchtturmprojekten mit entsprechender Innen- und Außenkommunikation kann die Digitalisierung positiv fördern und eine Signalwirkung sein. Pilotprojekte machen die Veränderungen der Stadt positiv spürbar und vermitteln die Dynamik und Energie der Stadt.
Methodik
Für die Studie haben wir Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern und alle Landkreise Deutschlands von einem unabhängigen Marktforschungsinstitut zum Stand und den Herausforderungen der Digitalisierung befragen lassen. Zusätzlich haben wir die 25 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands unter die Lupe genommen und aus den Ergebnissen ein Ranking der digitalsten Städte Deutschlands erstellt. Grundlage dafür sind 20 Indikatoren, die die Bereiche Verwaltung und Politik, Kommunikation, Infrastruktur und Energie abdecken.
Contact us