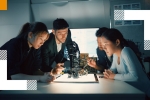Ihr Experte für Fragen

Benjamin Schrödl
Partner, Head of Real Estate M&A Germany bei PwC Deutschland
E-Mail
Bildungsimmobilien als attraktive Immobilienanlage für langfristig orientierte Investoren
Quo Vadis, deutsches Bildungssystem? Diese Frage begleitet die Diskussionen um die deutsche Bildungslandschaft seit Jahren. Wir wollen an dieser Stelle nicht die Bildungspolitik hinterfragen, sondern untersuchen, inwieweit Bildungseinrichtungen und im speziellen Schulimmobilien für Kapitalanlagegelder (wie zum Beispiel von Versorgungswerken und Pensionsfonds) interessant sein können.
Denn der Blick auf die Zahlen zeigt, dass hier eine Einbeziehung von privaten Akteuren sinnvoll für die Bewältigung der anstehenden Investitionsherausforderungen sein kann. Der Finanzierungsbedarf von Schulimmobilien ist groß und die Anzahl der benötigten Schulplätze steigt seit 2022/23 stetig an. Die zu erwartenden Renditen sind stabil und bieten somit attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Investoren mit einem langfristigen und risikoarmen Anlagehorizont – so die Ergebnisse der aktuellen PwC-Studie „Investieren in Bildungseinrichtungen in Deutschland (am Bsp. Schule)“.
Fazit: Für Investoren, die langfristige Investments im Fokus haben, sind Bildungsimmobilien eine attraktive Ergänzung in ihr Anlageportfolio. Investitionen in Bildungsimmobilien sind mit einer hohen ESG-Konformität (mit Fokus auf dem „S“ für Social) zudem gesellschaftlich von zentraler Bedeutung und nachhaltige Investments.
Die Studie im Überblick
Assets mit moderatem Rendite-Risiko-Profil und hoher ESG-Konformität
Der Markt für Investitionen in Bildungsimmobilien ist für Investoren attraktiv – gesicherte Cashflows und ein geringes Ausfallrisiko bieten hohe Sicherheit, egal, ob es sich dabei um Investitionen in einen Ersatzneubau, in die Sanierung bestehender Gebäude oder in zusätzliche Schuleinrichtungen handelt.
Deutschland verfügt insgesamt über 32.666 Schulen, davon sind ca. 88 Prozent öffentlich und ca. zwölf Prozent in privater Hand. Die knappen finanziellen Mittel vieler Kommunen erfordern die Beteiligung von privatwirtschaftlichen Investoren, die gewillt sind, die Investitionen in Sanierung oder Neubau zu tragen.
Überblick Bildungseinrichtungen in Deutschland
32.666 Schulen in Deutschland, die deutliche Mehrheit davon in öffentlicher Hand
| Schulformen nach Bundesland | Total | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| Schulen | 32666 | 5074 | 4646 | 1298 | 1459 | 203 | 665 | 3653 | 710 | 3418 | 5097 | 1520 | 311 | 1569 | 872 | 1300 | 871 |
| Vorklassen & Schulkindergärten | 1207 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 294 | 0 | 217 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschulen | 15510 | 2204 | 2418 | 443 | 518 | 106 | 224 | 1197 | 327 | 1699 | 2795 | 962 | 162 | 843 | 496 | 690 | 426 |
| Schulartunabhängige Orientierungsstufe | 1070 | 0 | 1 | 429 | 507 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptschulen | 1717 | 267 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 126 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schularten mit mehreren Bildungsgängen | 1903 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 20 | 195 | 551 | 115 | 185 | 1 | 368 | 126 | 0 | 188 |
| Realschulen | 1710 | 476 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 163 | 373 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnasien | 3156 | 457 | 434 | 112 | 106 | 13 | 77 | 315 | 75 | 291 | 624 | 151 | 36 | 177 | 85 | 104 | 99 |
| Integrierte Gesamtschulen | 2210 | 575 | 2 | 181 | 45 | 67 | 81 | 126 | 24 | 107 | 368 | 56 | 61 | 4 | 58 | 375 | 80 |
| Freie Waldorfschulen | 240 | 57 | 25 | 12 | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 | 23 | 44 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 5 |
| Förderschulen | 2795 | 555 | 357 | 93 | 96 | 6 | 31 | 218 | 79 | 232 | 512 | 131 | 40 | 158 | 99 | 116 | 72 |
| Abendschulen & Kollegs | 292 | 53 | 14 | 28 | 26 | 7 | 6 | 38 | 4 | 9 | 78 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 |
Quelle: PwC Studie „Finanzierungsrückstand im Bildungswesen birgt Potenziale“
Es gibt sechs verschiedene Gruppen von Bildungseinrichtungen in Deutschland: Einrichtungen vor Schulbeginn (Kitas und Kindergärten), Berufsschulen, Schulen, Schulen für den zweiten Bildungsweg, Förderschulen und weiterführende Bildungswege (private und öffentliche Hochschulen und Universitäten). Die Verteilung der Einrichtungen ist deutschlandweit sehr ungleich – in Bezug auf die Anzahl stehen Nordrhein-Westfalen gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern an der Spitze der Bundesländer.
Zudem steigt der Bedarf an Schulplätzen seit dem Schuljahr 2022/23 stetig an – Studien gehen von einem Mehrbedarf von + sechs Prozent aus, was ca. 700.000 Schulplätzen entspricht. Gründe dafür sind eine gestiegene Geburtenrate, die Zuwanderung sowie Wanderungsbewegungen innerhalb Deutschlands. In den urbanen Ballungsräumen wird sich der gestiegene Bedarf besonders deutlich auswirken (Quelle: Statistisches Bundesamt).
Anzahl der Schulplätze für allgemeinbildende und berufliche Schulen im Schuljahr 2023/2024
+ 6 % Mehrbedarf an Schulplätzen
Quelle: PwC Studie „Finanzierungsrückstand im Bildungswesen birgt Potenziale“
Zum Download der vollständigen Studie
„Investieren in Bildungseinrichtungen in Deutschland (am Bsp. Schule)“
Gute Voraussetzungen für Investoren, die langfristig planen
Während in Schulimmobilien in den letzten Jahrzehnten kaum investiert wurde und sich ein Finanzierungsrückstand aufgebaut hat – ca. 55 Mrd. Euro – wird nun privates Kapital zum aufholen dieses Rückstandes benötigt. Der Bedarf ist da, die Einnahmenseite durch langfristige Mietverträge mit einem meist öffentlichen Mieter gesichert und die Rendite stabil: Auch wenn die Drittverwendungsfähigkeit der Objekte u. U. eingeschränkt ist, kann das Rendite-Risiko-Profil der Investments in Schulimmobilien als sehr moderat eingestuft werden. Denn die öffentliche Hand als Mieter bedeutet Planungssicherheit für Investoren – und dies insbesondere in einem Marktumfeld, das in Bezug auf andere Assetklassen von Unsicherheit geprägt ist.
Öffentliche Trägerschaft dominiert
Die deutschen Bildungseinrichtungen sind überwiegend in öffentlicher Hand und werden von staatlichen Stellen wie Kommunen oder Bundesländern verwaltet. Ihre Finanzierung erfolgt aus öffentlichen Haushalten die gesetzlich verpflichtet sind, für das Bildungswesen zu sorgen. Daneben gibt es andere Akteure wie z. B. kirchliche Träger, gemeinnützige Körperschaften und Stiftungen oder private Investoren – letztere zu einem geringen Anteil. Investitionen in Bildungseinrichtungen können durch die öffentliche Hand, den privaten Sektor oder in Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und privater Hand erfolgen – es gibt eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.
Zu den Aufgaben der Schulträger gehören die Errichtung, die Organisation und die Verwaltung sowie der eigentliche Schulbetrieb. Fehlt es dem Träger an finanziellen Mitteln wird insbesondere der Bereich Errichtung und Bereitstellung von Materialien ausgelagert – vorzugsweise an einen Investor mit langfristigem Anlagehorizont. Daraus ergeben sich für Partner verschiedene Investitionswege, je nachdem, mit welchem Nutzer/Mieter sie zu tun haben.
Renditechancen in dringend benötigten Zukunftsinvestitionen
Die Einschätzung der Rendite von Investitionen in Bildungsimmobilien ist aufgrund der sehr begrenzten Datenlage schwierig: Belastbare Vergleichskennzahlen sind nur eingeschränkt bis gar nicht vorhanden – aus dem einfachen Grund, dass bisher noch kein klassischer Investmentmarkt für Bildungsimmobilien gegeben ist.
Zwar zählen Schulimmobilien zu den Spezialimmobilien und haben somit ein höheres Risikoprofil, v. a. durch die eingeschränkte Drittverwendungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite reduzieren langlaufende Mietverträge mit der öffentlichen Hand das Investitionsrisiko signifikant, so dass zu erwartende Rendite für Investments in fertig errichtete Schulen aktuell bei rund 4,5 bis 5,5 Prozent pro Jahr liegen. Darüber hinaus tragen Investitionen in Schulimmobilien einen sozialen Mehrwert in sich, der von den Banken positiv gewertet wird.
ESG-Bonus macht Investitionen in Schulimmobilien zukunftsfähig
Nachhaltige Investitionen stehen bei Kapitalgebern hoch im Kurs: Sie müssen sich hinsichtlich der Umweltziele an den aktuellen EU-Taxonomie-Vorgaben orientieren. Investitionen in Schulimmobilien entsprechen durch den sozialen Impact dem „S“ von ESG und erfüllen damit eine wichtige Finanzierungsanforderung der Banken.
In den kommenden Jahren ist mit einer zunehmend stärkeren Integration sozialer Kriterien in die Taxonomie-Verordnung zu rechnen, wodurch ESG-konforme Objekt langfristig attraktiv und handelbar bleiben.
Es ist zu erwarten, dass sich soziale-Infrastruktur-Investments wie Schulen als beliebte Assets etablieren werden. Schon heute nehmen wir eine wachsende Zahl an speziellen Fonds bzw. Schulimmobilien als Beimischung in den Portfolios wahr.
Weitere Studienergebnisse im Überblick
- Förderprogramme und Hilfen
- 6-8 Prozent-EK-Rendite bei Entwicklungen
- Erfolgreiche Schulbaupolitik
Förderprogramme und Hilfen
Für Bildungseinrichtungen mit einem öffentlichen Träger stehen Förderprogramme und Investitionshilfen auf Bundes- und auf EU-Ebene zur Verfügung, außerdem über Stiftungen, Spenden und schulische Eigeninitiativen. Von diesen Hilfen können zum Teil auch private Investoren profitieren, sie sind in jedem Fall individuell und auf das Projekt bezogen zu prüfen. In der Praxis werden bislang überwiegend staatliche Förderungen im Bereich Energie wahrgenommen.
„Investments in Bildungseinrichtungen sind gesellschaftlich dringend benötigte Zukunftsinvestitionen, die für die Investoren langfristig, stabil und nachhaltig sind.“
Benjamin Schrödl,Partner, Head of Real Estate M&A Germany bei PwC DeutschlandZum Download der vollständigen Studie
„Investieren in Bildungseinrichtungen in Deutschland (am Bsp. Schule)“
Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie unsere Expert:innen
Contact us