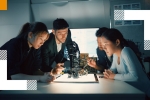Wie kann Profifußball wieder attraktiver für die Fans werden?
20 Dezember, 2018
Zu einem spannenden Fußballspiel gehören vollbesetzte Zuschauerränge mit einer guten und friedlichen Stimmung. Die Zuschauerzahlen in den Stadien gehen allerdings tendenziell zurück. Die Kluft zwischen Fußballbegeisterten und den wirtschaftlichen Interessen der Clubs, Sponsoren, Spielerberater, Medien und nicht zuletzt der Spieler wächst. Im Stadion und in den sozialen Medien üben die Fans zum Teil massive Kritik an den Entwicklungen im Profifußball.
Damit der Fußball attraktiv bliebt – sportlich wie wirtschaftlich – müssen die Interessen der Fans und der Wirtschaft im Gleichgeweicht sein. Diese Balance droht jedoch zu kippen. PwC-Partner Dr. Jörg Wulfken gibt im Interview Denkanstöße, welche Reformen außerhalb des Spielfelds dazu beitragen können, den Profifußball wieder attraktiver für die Fans zu gestalten.

Herr Dr. Jörg Wulfken, es kursieren aktuell zahlreiche Vorschläge, wie man den Profifußball im Sinne der Fans reformieren könnte. Was halten Sie von der Schaffung einer europäischen Superliga ohne Auf- und Abstieg?
Nicht viel! Die Idee ist auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet und berücksichtigt nicht das kulturelle Erbe des Fußballs. Zu diesem Erbe gehören die sportliche Qualifikation und die Verwurzelung in den nationalen Ligen. Wer das beeinträchtigt, wird auf Dauer die wirtschaftliche Grundlage des Fußballs beschädigen. Die Basis des Fußballs liegt zuallererst im Stadion – das gilt für Bayern München genauso wie für den FC Schalke 04, FSV Mainz 05 oder RB Leipzig, um nur einige Beispiele zu nennen.
Was schlagen Sie stattdessen vor, um den Fußball im Sinne der Fans zu verändern?
Ich finde es wichtig, den Besuch der Stadien attraktiv zu machen. Maßgeblich ist zunächst natürlich, dass der Sport attraktiv ist. Die Zuschauer freuen sich auf spannende Spiele mit möglichst vielen Toren. Aber auch der Komfort der Stadien und der übrigen Infrastruktur ist wichtig. Dazu gehören eine bequeme Anreise, ein ausreichendes Parkplatzangebot und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder eine zentrale Lage in der Stadt. Im Stadion selbst erhöhen Überdachungen, qualitativ hochwertiges Catering zu vernünftigen Preisen, eine gute Sicht auf das Spielfeld von allen Plätzen sowie stabile WLAN-Netze den Komfort. In vielen Stadien sind Investitionen in eine verbesserte Infrastruktur dringend nötig, um die hohen Eintrittspreise zu rechtfertigen. Dazu kommt: Stadionbesuche im Sommer sind angenehmer als im Winter. Daher sollte die viel zu lange Sommerpause in der Bundesliga verkürzt und die Winterpause verlängert werden. Das gilt zumindest, wenn nach der Saison keine Fußball-WM oder EM anstehen.
In der Diskussion steht auch immer wieder der Videobeweis. Wie sehen Sie das?
Ich halte den Videobeweis für problematisch, egal ob in der Bundesliga, der Champions League oder bei Länderspielen. Per Video überprüfte Millimeterentscheidungen bei Abseitspositionen, Elfmetern oder subtilen Handspielen sind für den Stadionbesucher während eines Spiels nicht mehr nachvollziehbar. Das Eingreifen des Videoschiedsrichters mindert die Erlebnisfreude der Zuschauer. Der exzessiv eingesetzte Videobeweis zeigt klar: Der mediale Konsum eines Bundesliga- oder Länderspiels ist wichtiger als der Stadionbesucher. Im Interesse der Zuschauer vor Ort sollte der Videobeweis deshalb abgeschafft oder nur bei offensichtlich groben Fehlentscheidungen des Schiedsrichters herangezogen werden.
Sie plädieren zudem dafür, die Wettbewerbsgerechtigkeit zu erhöhen. Wie kann das gelingen?
Zum Sport gehören faire Regeln. Das gilt auf dem Spielfeld ebenso wie außerhalb des Platzes, zum Beispiel bei den Voraussetzungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Clubs. Eine wesentliche Einnahmequelle der Clubs sind Fernsehgelder. Die Verteilung dieser Gelder erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Vor allem der Tabellenplatz der vergangenen fünf Jahre spielt dabei eine zentrale Rolle. Dadurch geht die Schere zwischen den Einnahmen der Bundesligavereine immer weiter auf. Im Interesse der Wettbewerbsgerechtigkeit halte ich es deshalb für wichtig, dass Leistungen unabhängig von der Größe eines Clubs besser berücksichtigt werden. Insbesondere die Nachwuchsförderung müsste stärker honoriert werden. So hätten auch Vereine aus der 2. und 3. Liga die Möglichkeit, sich positiv zu entwickeln und die Abstände zu den „Großen“ zu verringern. Als zusätzliche Säule im Verteilungsschlüssel sollte die Auslastung der Stadien und insbesondere die Anzahl der Tickets bei Auswärtsspielen mit einfließen. Dabei sollte es weniger auf die absolute Zuschauerzahl bei Heimspielen, sondern auf die Auslastung der Stadien ankommen, da ansonsten Clubs in großen Städten mit großen Stadien begünstigt wären. Eine Sonderregelung könnte man für Clubs wie Hertha BSC finden, die aus historischen Gründen in einem Stadion spielen, das für die eigenen Bedürfnisse viel zu groß ist. Das würde einen ökonomischen Anreiz für die Clubs schaffen, den Stadionbesuch attraktiver zu machen und Anhänger für Auswärtsspiele zu mobilisieren.
Ein heiliger Gral ist die 50+1-Regel, die verhindern soll, dass Investoren die Kontrolle über deutsche Vereine erlangen. Wie stehen Sie dazu?
Die Regel führt im Ergebnis zu einer Verfestigung der Ungleichheit und Wettbewerbsverzerrungen im deutschen Profifußball. Um den unbeschränkten Zugang privater Investoren als Eigentümer von Clubs zu verhindern, muss 50+1 durch eine bessere Regel ersetzt werden. Hierfür bietet sich ein Blick über die Grenzen des Fußballs an. So ist etwa auch der Zugang zum Eigentum von Banken und Versicherungen beschränkt. Wer zehn Prozent oder mehr an einer Bank oder Versicherung erwerben möchte, muss ein sogenanntes Inhaberkontrollverfahren durchlaufen. Ein ähnliches Verfahren wäre auch bei der Zulassung von Eigentümern bei Fußballclubs denkbar. Für alle Clubs von der Bundesliga bis zur zweiten und dritten Liga würden einheitliche Regeln gelten. Die Vereine könnten so in einen fairen Wettbewerb um geeignete Investoren eintreten.
Wie würde sich eine solche Regelung auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Clubs auswirken?
Es ist illusorisch zu glauben, dass eine Eigentümerkontrollregel international auf viel Gegenliebe stoßen würde. Die großen europäischen Fußballländer England, Italien, Spanien und Frankreich haben keine 50+1-Regel. Aber hier gilt: Auch mit 50+1 waren deutsche Clubs in den internationalen Wettbewerben wie der Champions League sehr erfolgreich – siehe Bayern München und Borussia Dortmund. Außerdem besteht nicht immer ein Zusammenhang zwischen der Eigentümerstruktur eines Clubs und seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. DFB und DFL verfügen über ausreichenden internationalen Einfluss, um sich auf UEFA-Ebene für faire Wettbewerbsbedingungen einzusetzen.
Auch die exorbitanten Ablösesummen bei Spielertransfers tragen zu einer Entfremdung von Fans und Clubs bei. Was schlagen Sie zu diesem Thema vor?
Ich bin der Meinung, dass der Transfermarkt selbst reformbedürftig ist. So sind seitens der FIFA international zwei Transferperioden vorgesehen. Das Wechselfenster im Winter kann erheblich zu Unruhe in der Mannschaft während einer Saison beitragen. Funktionierende Teams werden während einer laufenden Saison auseinandergerissen, Wettbewerber mitten in der Saison gezielt geschwächt. Die Zusammenstellung eines Teams sollte vor Saisonbeginn für die gesamte Saison verbindlich geplant werden. Dies gibt den Fans Zeit, sich länger mit einer Mannschaft und einzelnen Spielern zu identifizieren.