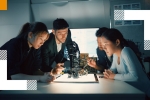Ein Interview mit Roland Werner, Michael Ey und Thorsten Weber. Das deutsche Gesundheitswesen zählt zu den besten Systemen weltweit. Gilt das auch aus Sicht derer, die es nutzen – der deutschen Bevölkerung? Wie zufrieden sind die Bürger:innen mit ihrer Gesundheitsversorgung? Was kritisieren sie, in welchen Bereichen sehen sie Reformbedarf? Antworten gibt das „Healthcare-Barometer 2024“, für das PwC bereits zum zehnten Mal in Folge 1.000 Bürger:innen befragt hat. Im Interview erklären Roland Werner (Leiter Gesundheitswirtschaft & Pharma bei PwC Deutschland), Michael Ey (Co-Lead Gesundheitswirtschaft bei PwC Deutschland) und Thorsten Weber (Leiter Beratung GKV bei PwC Deutschland), wie sie die Ergebnisse werten.

Nur noch 52 Prozent der Deutschen zählen das deutsche Gesundheitswesen zu den Top-3-Systemen weltweit, lediglich acht Prozent glauben, dass Reformen es voranbringen können. Schwindet das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Reformkraft des deutschen Gesundheitssystems?
Roland Werner: Zweifelsfrei gehört das deutsche Gesundheitswesen nach wie vor zu den besten Systemen der Welt. Während der COVID-19-Pandemie sind die Zustimmungswerte in der Bevölkerung sprunghaft angestiegen – offenbar als Anerkennung der Leistungen in der Pandemiebekämpfung – und haben sich seitdem wieder auf Normal-Niveau eingependelt. Wir sehen vor allem auch einen wieder gestiegenen, deutlichen Unterschied in der Bewertung von Pharmaunternehmen, Krankenhäusern und Krankenkassen. Wir sollten zudem ernst nehmen, dass die Zufriedenheitswerte gegenüber dem Vorjahr noch einmal um fünf Prozentpunkte gesunken sind. Aus meiner Sicht spiegelt sich darin eine hohe Unsicherheit in der Bevölkerung wider.
Die Menschen lesen in den Medien, dass Ärzt:innen streiken, dass Fachkräfte fehlen und Medikamente nicht erhältlich sind. Das hat Auswirkungen auf das Vertrauen in unser Gesundheitssystem. Gering ausgeprägt ist auch die Zuversicht in die Reformkraft unseres Gesundheitswesens, insbesondere unter älteren Menschen. In diesen Punkten müssen Gesundheitspolitik und weitere Akteur:innen der Gesundheitsversorgung dringend gegensteuern.
Wie kann es gelingen, wieder mehr Vertrauen in unser Gesundheitswesen aufzubauen?
Michael Ey: Die angesprochene Unsicherheit gilt insbesondere für den Krankenhausbereich. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über die stockende Krankenhausreform oder die zugespitzte Liquiditätssituation der Krankenhäuser berichtet wird. Wir müssen aus dem Krisenmodus wechseln in eine dringend nötige Debatte über ein belastbares Zukunftskonzept für unser Gesundheitswesen. In vielen Bereichen heißt das, Gesundheit neu zu denken: etwa durch eine bessere Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors oder die konsequente Nutzung von Telemedizin und Digitalisierung.
Statt vorrangig über Level oder Leistungsgruppen von Krankenhäusern zu diskutieren brauchen wir ein klares Zielbild für Gesundheitsstandorte, die eine leistungsfähige Primär- und Notfallversorgung sicherstellen und für Patient:innen eine Art Lotsenfunktion übernehmen.
Dadurch lassen sich auch zahlreiche Probleme angehen, die unser Gesundheitswesen belasten: teure Doppeluntersuchungen, die Überlastung der Notaufnahmen und steigende Kosten in einer alternden Gesellschaft.
Wesentlicher Eckpunkt der geplanten Reformen im Gesundheitswesen ist der Umbau der Krankenhauslandschaft. Wie stehen die Menschen in Deutschland dazu?
Ey: Wir haben derzeit eine sehr heterogene Krankenhauslandschaft mit einer hohen Anzahl von Häusern und einem unterschiedlichen Spezialisierungsgrad. Die geplante Krankenhausreform sieht vor, dass die Krankenhäuser künftig anders finanziert werden und die Zahl der Kliniken sich zugunsten einer stärkeren Spezialisierung verringern soll. Wie unsere Befragung zeigt, sind die Bürger:innen bereit, die Krankenhaus-Reform zumindest teilweise mitzutragen. So erklären sich 77 Prozent der Menschen bereit, für eine komplexe und aufwändige Behandlung lange Wege in Kauf zu nehmen. Allerdings fürchten die Bürger:innen auch, dass die wohnortnahe Versorgung gefährdet sein könnte: 47 Prozent zählen Defizite im ländlichen Raum zu den Top-Herausforderungen der Gesundheitsbranche. Grundsätzlich halten neun von zehn Bürger:innen aber Reformen im Gesundheitswesen für notwendig, wie eine Studie der Bertelsmann Stiftung gezeigt hat.
Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie unseren Experten
Die Krankenversicherungen schneiden beim Healthcare-Barometer traditionell gut ab. Die Bürger:innen trauen ihnen in Sachen Digitalisierung und Innovation viel zu. Wie erklären Sie sich das?
Thorsten Weber: Richtig, mit 87 Prozent Zufriedenheit sind die Werte seit Jahren stabil – daran können auch die gestiegenen Zusatzbeiträge nichts ändern. Ebenso ist das Vertrauen in die Transformationskraft recht hoch: 56 Prozent bewerten die Krankenversicherungen in puncto Innovation und Digitalisierung als fortschrittlich. Das gilt insbesondere für jüngere Menschen. Von diesen Zahlen sollten wir uns allerdings nicht blenden lassen – aus meiner Sicht sind die Krankenkassen durchaus innovativ, etwa wenn es um Gesundheitsapps geht.
Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch aus: die Einführung und vor allem die produktive Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePa), mit der alle Leistungserbringer:innen über eine Schnittstelle dann digital Informationen abrufen können. Das ist die eigentliche Hürde bei der Digitalisierung. Aber auch eine große Chance für das Gesundheitswesen insgesamt.
Wie stehen die Bürger:innen zur elektronischen Patientenakte, kurz ePa, einem der wesentlichen Reformprojekte der Gesundheitspolitik? Was kann für noch mehr Akzeptanz getan werden?
Weber: Die Mehrheit der Befragten weiß zu wenig über das Opt-Out-Verfahren bei der elektronischen Patientenakte. Die Regelung sieht vor, dass alle Versicherten eine ePa erhalten, sofern sie nicht widersprechen. Derzeit unterstützen lediglich 35 Prozent das Opt-Out-Verfahren uneingeschränkt und halten es für ein sinnvolles Instrument zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. 27 Prozent sind noch unschlüssig und möchten mehr über die Vor- und Nachteile der Regelung erfahren, 14 Prozent stehen dem Thema neutral gegenüber. Zu dem Thema ist dringend noch mehr Aufklärungsarbeit zum Mehrwert der ePa notwendig – auch von Seiten der Krankenkassen.
Wie die Studie zeigt, hat die Pharmabranche ihr Image verbessern können, wird aber noch immer überwiegend als Gewinnmaximierer wahrgenommen. Was können die Unternehmen dagegen tun?
Werner: Während der Pandemie konnten deutsche Pharmaunternehmen ihr Image verbessern, weil sie schnell und pragmatisch einen Impfstoff entwickelt haben, der in der ganzen Welt gefragt war. Diesen Imagegewinn können die Unternehmen auch nach der Pandemie weitgehend halten: 31 Prozent der Deutschen sagen, dass Pharmaunternehmen innovative Firmen sind, die mit ihren Produkten Krankheiten heilen. Gerade jüngere Befragte stimmen dieser Aussage zu.
Aus meiner Sicht hat die Öffentlichkeit inzwischen verstanden, dass es vor allem die Innovationskraft und die Forschungsleistung sind, die vergütet werden müssen. Dazu müssen auch die europäischen Produktionsstandorte gestärkt werden, denn die Nachfrage ist hoch. So bestätigt fast jede:r Sechste: Es ist wichtig, dass Medikamente in Europa hergestellt werden.
Der Zugang zu Gesundheitsdaten ist für die Pharmabranche – ebenso wie für alle anderen Bereiche des deutschen Gesundheitswesens – von großer Bedeutung. Wie ausgeprägt ist die Bereitschaft der Bürger:innen, Daten zu teilen?
Weber: Überraschend hoch – acht von zehn Deutschen wären bereit, ihre persönlichen Gesundheitsdaten der medizinischen Forschung bereitzustellen. Die Hälfte der Befragten erwartet allerdings eine Gegenleistung in Form eines Mehrwertes oder eines Entgelts. Aus meiner Sicht müssen wir noch deutlicher als bisher herausstellen, welche Chancen die Digitalisierung für die Gesundheitsversorgung mit sich bringt. Durch die systematische Nutzung von Gesundheitsdaten können wir unsere Gesundheitsversorgung weiterentwickeln und passgenau auf den einzelnen Menschen zuschneiden. Stichwort ist hier die Präzisionsprävention.
Werner: Hier wird entscheidend sein, dass die verschiedenen Bereiche der Gesundheitswirtschaft eng und effektiv zusammenarbeiten – die produzierenden Pharmaunternehmen, die ambulanten und stationären Leistungserbringer und die Krankenkassen als Kostenträger. Diese Schnittstellen werden immer wichtiger und dadurch stellen wir die Bürger:innen in den Mittelpunkt.

Healthcare-Barometer 2024
Die Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen gegenüber den Vorjahren ist spürbar gesunken. Das sind ein zentrales Ergebnis des „Healthcare-Barometers 2024“, für das PwC – bereits zum zehnten Mal in Folge – 1.000 Bürger:innen zu ihrer Einschätzung des deutschen Gesundheitswesens befragt hat. Lesen Sie hier alle Insights der Studie.