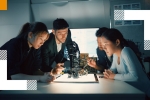Interview: „Die Reform wird Krankenhäuser in Gewinner und Verlierer unterteilen“
13 März, 2023
Michael Burkhart im Gespräch zum Gesetzesentwurf der Reform der Krankenhausversorgung. Die Bundesregierung hat ein Konzept zur Reform der Krankenhausversorgung von einer Expertenkommission erarbeiten lassen. Lassen sich damit die Probleme des deutschen Gesundheitswesens lösen?
Kann so die prekäre Finanzlage vieler Krankenhäuser überwunden werden? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Kliniken? Im Interview erklärt Michael Burkhart, bis Juli 2023 Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC Deutschland, wie er den Reformvorschlag bewertet.

„Weniger Ökonomie, mehr Medizin“ – das verspricht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit der geplanten Reform der Krankenhausversorgung. Was halten Sie von diesem Versprechen?
Michael Burkhart: Ich teile die Einschätzung, dass wir dringend eine Reform unserer Krankenhausversorgung brauchen. Die Kliniken stehen heute unter einem starken finanziellen Druck. Die DRGs sind allerdings nicht die Ursache, sondern das Warnzeichen. Daher glaube ich nicht daran, dass die Bundesregierung mit den geplanten Maßnahmen mehr erreicht, als die Warnzeichen zu überdecken, die Ursachen aber nicht zu bekämpfen. Was ich bei dem von Expert:innen vorgelegten Entwurf am meisten vermisse, ist ein klares gesellschaftliches Ziel. Wünschen wir uns eine flächendeckende, wohnortnahe Versorgung? Oder möchten wir die bestmögliche Versorgung in spezialisierten Zentren, die unweigerlich zu einer Konzentration in der deutschen Krankenhauslandschaft führen würde? Wollen wir eine Optimierung je Krankenhaus oder dürfen sich Kliniken in einer Region spezialisieren und werden als Verbund betrachtet?
Die Beantwortung dieser Fragen ist deshalb wichtig, weil sie Zielkonflikte darstellen, die nicht oder nur begrenzt gleichzeitig erfüllt werden können. Daher vermisse ich die Antworten auf diese Fragen. Auch das Problem des Fachkräftemangels geht der Bundesgesundheitsminister nicht an. Ich fürchte, dass damit die Zustimmung der Bürger:innen zum deutschen Gesundheitswesen weiter sinken wird.
Schon jetzt zählen es nur noch 57 Prozent zu den drei besten Systemen der Welt, wie unser „Healthcare-Barometer 2023“ gezeigt hat. Vor wenigen Jahren waren dies noch deutlich mehr (knapp 70 %).
Rund 60 Prozent der Kliniken schreiben rote Zahlen. Glauben Sie, dass sich durch die Reform die Finanzierungslücke der Kliniken überwinden lässt?
Burkhart: Nein, ich glaube nicht, dass die Vorschläge der Expertenkommission zu einer Entlastung der Krankenhäuser führen werden. Wichtige Fragen der Finanzierung bleiben nach wie vor unbeantwortet. Die Kliniken müssen seit vielen Jahren erhebliche Finanzierungslücken verkraften und aus dem laufenden Betrieb ausgleichen, weil die Bundesländer ihrer Pflicht zur Zahlung der Investitionskosten nicht in ausreichendem Maße nachkommen. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem – nicht das System der Fallpauschalen, das mit der Neuregelung angegangen werden soll. Die Reform führt nur zu einer Umverteilung der Gelder, sodass es Gewinner und Verlierer geben wird.
Wer sind aus Ihrer Sicht die Gewinner, wer die Verlierer der geplanten Reform?
Burkhart: Nach dem Reformvorschlag der Expert:innen wird die deutsche Krankenhauslandschaft künftig in drei Versorgungsstufen unterteilt: Level eins für die medizinische Grundversorgung, Level zwei für die Regel- und Schwerpunktversorgung und Level drei für die Maximalversorgung, zum Beispiel in Universitätskliniken.
Gewinner werden die Universitätskliniken und größere Klinikverbünde sein, die in der Regel in allen Versorgungsbereichen (stationär, ambulant und rehabilitativ) tätig sind und ihre Ressourcen, z.B. Geburtshilfen und Stroke-Units mittelfristig entsprechend umschichten können, was zu einem Wettbewerb des “uplevels” und damit wieder zu einem Wettbewerb führen wird. Verlierer sind die kleineren Kliniken in ländlichen Regionen, die über solche Ressourcen nicht verfügen und deren finanzielle Situation sich noch verschärfen wird.
Dadurch könnte eine Zwei-Klassen-Medizin entstehen. Die Gefahr besteht z.B., dass Mediziner:innen und Pflegekräfte zu den größeren Häusern abwandern und zu einem langsamen Sterben der kleineren Krankenhäuser führen wird.
Welche weiteren Risiken sind mit der geplanten Reform verbunden?
Burkhart: Ich sehe vor allem das Risiko der „Rosinenpickerei“ – durch die Vorsorgepauschale werden (teilweise) die Fixkosten ohne Leistung gedeckt. Wenn die Kliniken sich betriebswirtschaftlich optimieren wollen, müssen sie sich künftig auf solche Leistungen konzentrieren, die ihnen hohe Deckungsbeiträge versprechen. Damit besteht die Gefahr, dass sie (ggf. unbewusst) einen Teil ihres Versorgungsauftrags vernachlässigen. Insgesamt fürchte ich, dass die Qualität der medizinischen Versorgung in den Hintergrund rückt, weil eine Art Level-Kampf einsetzt, die Kliniken also versuchen werden, die nächst höhere Versorgungsstufe zu erreichen (z.B. durch die Schaffung von Geburtshilfen und Stroke-Units, um Frauenheilkunde und Kardiologie von Level 1 zu Level 2 zu erhöhen). Außerdem werden kleinere Häuser der Stufe eins im Rahmen der Facharzt- und Fachärztinnentausbildung zu Kooperationen gezwungen sein. Darüber hinaus wird Insgesamt der bürokratische Aufwand für die Krankenhäuser stark zunehmen: Im Reformentwurf sind 128 Leistungsgruppen mit entsprechenden Nachweispflichten eingeplant. Diese müssen geplant, dokumentiert und überwacht werden. Das wird zu einem hohen Verwaltungs- und Prüfaufwand führen.
Es ist bereits jetzt absehbar, dass die Reform zu einer Konzentration der deutschen Krankenhauslandschaft führen wird. Wie stehen Sie dazu?
Burkhart: Diese Einschätzung kann ich nur bestätigen. Ich denke, dass Deutschland auch mit der Hälfte der derzeit knapp 1.900 Krankenhäuser auskommen würde, ohne dass die Gesundheitsversorgung gefährdet wäre. Allerdings kämen wir nicht mit der Hälfte der Betten aus – die größeren Häuser müssten daher Kapazitäten aufstocken. Das ist aber nur die ökonomische Perspektive.
Für die Bürger:innen würde eine solche Konzentration bedeuten, dass sie zum Teil Anfahrtswege von 30 bis 50 Kilometern bis zur nächsten Klinik auf sich nehmen müssten. Dagegen werden sich viele Kommunen sicher wehren und versuchen, Schließungen zu verhindern. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit dazwischen: Eine Konzentration ist sinnvoll, aber es wird in sehr ländlich geprägten Regionen immer auch Ausnahmen geben müssen, um eine Unterversorgung zu vermeiden.
Wie können Krankenhäuser sich bestmöglich auf die bevorstehenden Änderungen vorbereiten?
Burkhart: Mit der geplanten Reform werden Krankenhäuser im Vorteil sein, die zahlreiche Leistungen entlang der Wertschöpfungskette anbieten. Sie können – je nach Finanzierungsanreiz – flexibler reagieren. Dadurch werden in der Praxis vor allem große Verbünde bevorzugt. Deshalb empfehle ich Einrichtungen, sich möglichst breit aufzustellen und viele Leistungen entlang der Wertschöpfungskette, etwa in den Bereichen ambulante und stationäre Versorgung, Prävention und Rehabilitation, anzubieten. Ich rate auch zu Kooperationen und dem Erwerb anderer Einrichtungen. Noch weiß niemand, in welchen Elementen der Wertschöpfungskette die meisten Gelder gezahlt werden.
Welchen Expertenvorschlag würden Sie für eine ganzheitliche Reform unseres Gesundheitswesens einbringen?
Burkhart: Ich bin davon überzeugt, dass wir unser Gesundheitswesen weit nachhaltiger als bisher ausrichten müssen. Durch die unzureichenden Investitionen der Bundesländer in die Gebäudestruktur haben wir einen Modernisierungsstau und eine veraltete Gebäudestruktur in der deutschen Krankenhauslandschaft. Wegen ihres hohen Energieverbrauchs sind Kliniken für einen wesentlichen Teil der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich – rund fünf Prozent, mehr als die Schifffahrt oder der Flugverkehr. Im öffentlichen Bewusstsein ist diese Tatsache allerdings noch nicht angekommen, wie unser „Healthcare-Barometer 2023“ zeigt: Lediglich 32 Prozent der Bürger:innen können dazu eine realistische Einschätzung abgeben.
Wenn wir die aktuellen Krisen – insbesondere den Klimawandel und die Energieknappheit – angehen wollen, müssen wir das Gesundheitswesen in die Pflicht nehmen. Und daher sollte das Thema ESG (Enviromental Social Governance) auch wesentlicher Bestandteil der bevorstehenden Krankenhausreform sein.
Contact us

Roland M. Werner
Partner, Leiter Gesundheitswirtschaft & Pharma, PwC Germany
Tel.: +49 170 7628-557