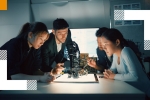Ihr Experte für Fragen

Roland Werner
Leiter Gesundheitswirtschaft & Pharma bei PwC Deutschland
Tel.: +49 170 7628-557
E-Mail
Krankenhäusern drohen vermehrte Einschnitte
Der Abstand zwischen öffentlichen und privaten Kliniken in Deutschland wird im Hinblick auf ihre finanzielle Situation immer größer. Ein Grund dafür sind unterschiedlich hohe Investitionen. Vor allem bei Kostendeckung und Liquidität schneiden die öffentlichen Krankenhäuser deutlich schlechter ab als die privaten und freigemeinnützigen Kliniken. Aber auch nachträgliche Rechnungskorrekturen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) bereiten dem Krankenhausmanagement zunehmend Sorge.
So lauten einige der wichtigsten Ergebnisse der Benchmark-Analyse „Krankenhäuser im Vergleich: Kennzahlen September 2020“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Dazu hat PwC die Jahresabschlüsse von mehr als 100 deutschen Kliniken in öffentlicher, gemeinnütziger und privater Trägerschaft untersucht und die wichtigsten Kennzahlen der Branche für das Jahr 2019 verglichen. Wie rentabel wirtschaften die Häuser? Wie steht es um Eigenkapital und Investitionen? Diese und andere Fragen zum Thema beantwortet das aktuelle PwC-Krankenhaus-Benchmarking.
Die Studie im Überblick
Öffentliche Kliniken sind Schlusslicht bei der Rentabilität
Die Rentabilität deutscher Kliniken bleibt vergleichsweise niedrig. Speziell bei den öffentlichen Häusern setzt sich der Abwärtstrend vergangener Jahre fort. Dies zeigt zum Beispiel die EBITDA-Quote, die um Abschreibungen und Fördermittel bereinigt ist. Mit -4,9 Prozentpunkten verschlechterte sich die Quote der öffentlichen Krankenhäuser im Vergleich zu 2018 noch einmal deutlich. Im Vorjahr lag sie immerhin noch bei 0,5 Prozentpunkten.
Freigemeinnützige Krankenhäuser verzeichnen einen moderaten Rückgang und zwar um 0,3 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent im Jahr 2019. Die Spitzenposition nehmen weiterhin die private Kliniken ein. Obwohl sie vergleichsweise weniger Fördermittel in Anspruch nehmen, wirtschaften sie rentabler als die Kliniken anderer Trägerschaften; bei ihnen liegt die EBITDA-Quote bei 7,8 Prozent (2018: 7,6 Prozent).

Mehr Rückstellungen für die Krankenkassen
Zunehmend auf Trab gehalten wird das Krankenhausmanagement durch nachträgliche Rechnungskorrekturen des MDK. Denn die MDK-Umsatz-Quote, das heißt die Rückstellungen im Verhältnis zu den Erlösen aus Krankenhausleistungen, beansprucht mit 84,5 Prozent den größten Teil des Gesamtumsatzes. Und die Quote prägt das Jahresergebnis ganz konkret: Während das Management 2017 noch nachträgliche Kürzungen von 2,1Prozent erwarteten, stieg die Quote bis Ende 2019 auf 2,4 Prozent. So rechnen private Krankenhäuser pro behandeltem Fall mit einem Rückstellungsbetrag von 104,74 Euro, freigemeinnützige mit 111,81 Euro und öffentliche mit 86,64 Euro. Im Schnitt sind das dann 101,06 Euro.
Hierbei sehen öffentliche Krankenhäuser im Jahresabschluss ein niedriges Risiko, wie die Studie anführt. Das kann daran liegen, dass der MDK ein größeres Augenmerk auf die Abrechnung privater Krankenhäuser legt. Diese wählen bei der Ermittlung ihrer MDK-Rückstellung oftmals einen konservativeren Ansatz als ihre Wettbewerber.
Private setzen Personal am effizientesten ein
Die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern spiegelt sich ebenso in der Material- und Personalaufwandsquote wider. Besonders die öffentlichen Kliniken wenden nach wie vor einen enormen Teil ihrer Gelder für Material und Personal auf: Er macht satte 92,1 Prozent der Umsatzerlöse (2018: ebenfalls 90,5 Prozent) aus. So bleiben den Häusern von 100 Euro nur acht Euro zum Beispiel für IT-Ausstattung, Wartung und Finanzierungen.
Im Vergleich wirtschaften private Krankenhäuser am effizientesten: Bei ihnen liegt die Material- und Personalaufwandsquote bei 84,2 Prozent (2018: 83,6 Prozent). Bei freigemeinnützigen Einrichtungen liegt sie immerhin noch bei 87,5 Prozent (2018: 87 Prozent). Über alle Trägerarten hinweg geben die Krankenhäuser von 100 Euro im Schnitt rund 29 Euro für Material und 61 Euro für Personal aus. Für den leichten Anstieg der Aufwände ist auch der anhaltende Mangel an Mitarbeitern in der Pflege verantwortlich. Denn zusätzlich benötigtes Fremdpersonal verbucht das Krankenhausmanagement als Materialaufwand (2019: 29,1 Prozent, 2018: 28,8 Prozent).

„Auffallend ist, dass unabhängig von der Trägerstruktur der Aufwand für Personal- und Material absolut wie relativ weiter angestiegen ist. Damit stehen alle Kliniken jedes Trägers vor massiven finanziellen Herausforderungen. Eine Revolution der Klinikfinanzierung scheint unausweichlich.“
Cash-Management leidet bei allen Trägern
Im Jahr 2019 verschlechterte sich das Cash-Management der deutschen Krankenhäuser. Viele Kliniken machen ihre Forderungen gegenüber den Krankenkassen zu spät geltend. Dringend benötigte Mittel stehen dadurch oft zu spät zur Verfügung. Vornehmlich betroffen sind öffentliche Häuser, die 2019 im Schnitt rund 59 Tage auf ihr Geld warteten. Auch die freigemeinnützigen Kliniken legten bei den Days Sales Outstanding (DSO) zu. Hier verzögerte sich die Wartezeit um einen Tag auf 49 Tage. Doch obwohl die privaten Häuser hier ebenfalls um einen Tag auf 46 Tage, liegen sie bei den DSO noch immer vorne.
Ähnliches gilt für die Finanzkennzahl Days Payables Outstanding (DPO). Das ist Anzahl der Tage, die das Krankenhausmanagement benötigt, um eingehende Rechnungen zu begleichen. Weil zahlreiche Häuser auch hier zu viel Zeit verstreichen lassen, verschenken sie Preisnachlässe. So brauchten öffentliche Krankenhäuser 2019 bis zur Zahlung im Schnitt 46, die freigemeinnützigen 33 und die privaten 25 Tage.
Dadurch sind die Kliniken häufig von fremden Geldgebern abhängig – mit entsprechend höheren Kapitalkosten. So war bei den Häusern in öffentlicher Trägerschaft 2019 die Eigenkapitalquote mit 10,2 Prozent weiterhin niedrig. Freigemeinnützige hielten dagegen 28,3 Prozent vor, die privaten Kliniken insgesamt 29,4 Prozent.
„Die öffentlichen Kliniken kommen mit einer niedrigen Eigenkapitalquote aus. Das liegt an der kommunalen Trägerschaft, die bei Bedarf mit Eigenkapitalerhöhungen, Entschuldungsplänen oder Investitionszuschüssen einspringt.“
Fördermittelquote bei öffentlichen Kliniken am höchsten
Im Vergleich aller Trägerschaften beziehen öffentliche Kliniken die meisten Fördermittel. Ihre Fördermittelquote, also das Verhältnis von fördermittelfinanzierten Abschreibungen zu den Gesamtabschreibungen, lag 2019 bei 67 Prozent. Die Quote zeigt zudem, wie eng die Investitionsstrategie eines Krankenhauses mit der Ergebnissituation verzahnt ist. Während die freigemeinnützigen Häuser mit 62 Prozent deutlich weniger Zuwendungen erhielten, war sie bei den privaten Kliniken mit 49 Prozent am niedrigsten. Insgesamt blieb das Fördermittelvolumen in jüngerer Vergangenheit konstant: So lag die Quote 2017 bei 58,7 Prozent, 2008 bei 59,5 Prozent und 2019 bei 60 Prozent.

Besonderes private Kliniken wollen bei Investitionen nicht lange auf Fördermittel warten. Von allen Trägern nahmen sie für Investitionen den größten Teil eigener Mittel in die Hand. So weisen sie mit 15,5 Prozent die höchste Investitionsquote auf gegenüber den öffentlichen (13,5 Prozent) und freigemeinnützigen Einrichtungen (12,7 Prozent). Die Vergabevorschriften für Fördermittel bringen einen erhöhten Arbeitsaufwand mit sich. Demgegenüber erscheint die Eigenmittelfinanzierung flexibler und bietet den Kliniken größere Spielräume.
Die Benchmark-Analyse illustriert zudem die unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangslagen der Kliniken, von der aus sie in die Corona-Pandemie gestartet sind. Auf der Basis dieser Kennzahlen ist es nachvollziehbar, dass die Bundesregierung für die Gesundheitswirtschaft das COVID-19-Krankenhaus-Entlastungsgesetz auf den Weg gebracht hat. Das Gesetz sieht unter anderem vor, das Zahlungsziel der Kostenträger auf fünf Tage zu verkürzen.
„Zu befürchten ist allerdings, dass die Lücke in den Liquiditätsplänen der Kliniken umso größer wird, sollte das Zahlungsziel wieder auf das Ausgangsniveau verlängert werden.“

Interview: Wirtschaftlich an der Spitze sind weiterhin die Kliniken in privater Trägerschaft
Im Gespräch mit Corinna Friedl und Michael Burkhart über die wichtigsten Erkenntnisse aus den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Kliniken.